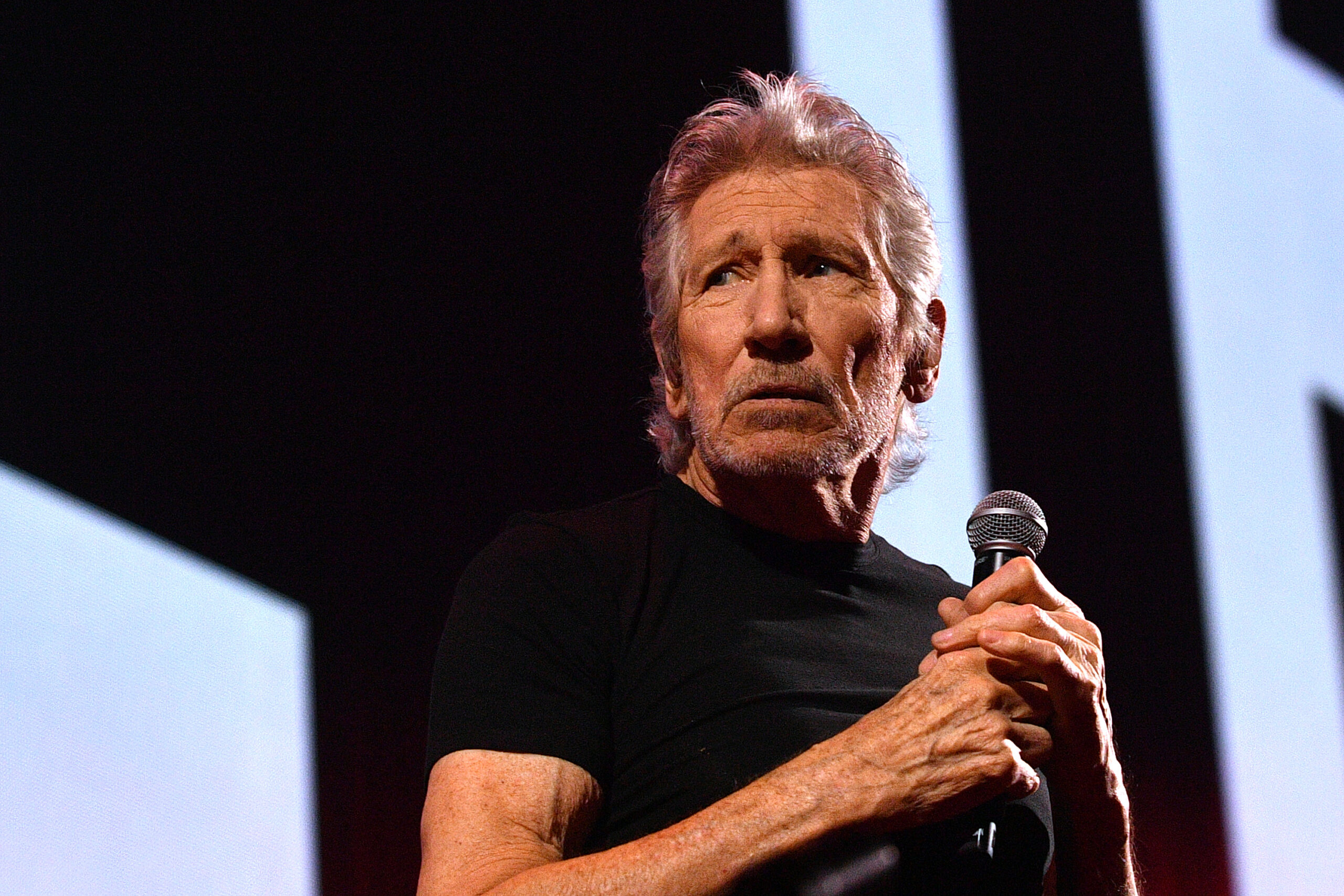Der Feind in meinem Ohr
Aus dem Pop-Entwicklungsland Schweden kommt Anfang der Siebziger eine Band, die kulturell aufgeklärte Menschen unmöglich ernst nehmen dürfen. Aber bald wird klar: Ihre Songs wird die Welt nie wieder vergessen können – und auch nicht wollen.
Die schwedische Gruppe Abba existierte gerade einmal zehn Jahre – von 1972 bis 1982. Doch diese Zeit genügte ihr, um als einer der erfolgreichsten Popacts in die Geschichte einzugehen. Aber wofür steht dieses Wort eigentlich: „Erfolg“? Abba haben irrsinnig viele Platten verkauft und tun dies noch heute. Ihre Musik läuft jeden Tag in so ziemlich jedem Winkel der Erde im Radio. Mit „Mamma Mia!“ gibt es seit 1999 ein sogenanntes „Jukebox“-Musical mit ihren größten Hits, das alle paar Monate in einem neuen Theater Premiere feiert und Konvois von Reisebussen anlockt. Und in jeder neuen Generation verknallen sich junge Menschen hoffnungslos in ihre Musik. Erfolg bedeutet also Präsenz. Im Rückblick auf die Siebziger dürfen wir im Fall von Abba sogar von Omnipräsenz sprechen. Denn setzt man sich unter Dauerbeschuss der 39 Hits aus ihren beiden Compilations Gold – Greatest Hits (1992) und More Abba Gold – More Abba Hits (1993), entsteht der Eindruck, ihnen gehörte dieses Jahrzehnt ganz allein. (Wer möchte, spüle sich danach die Ohren mit Präparaten von den Sex Pistols, Neu! oder Led Zeppelin, um diesen Eindruck zu revidieren. Das hilft. Vorläufig.)
Auch wenn der Massengeschmack einen schlechten Ruf hat, fällt auf, dass unter den Künstlern und Bands, die zu den weltweit erfolgreichsten Acts zählen (Beatles, Elvis Presley und Michael Jackson stehen ganz vorn in den Listen) die meisten durchaus ihre künstlerischen Qualitäten besitzen. Das gilt unbedingt auch für Abba. Nicht erst im anything goes der von ungezählten Retrowellen durchgeschaukelten Popmusik der vergangenen Jahre hat sich die breite Erkenntnis durchgesetzt, dass dieses Quartett Popware von herausragender Qualität produziert hat. Spätestens seit dem ersten großen, wenn auch noch mit einem ironischen Unterton versehenen Abba-Revival Anfang der 90er-Jahre wissen wir: Sie schufen Ohrwürmer für die Ewigkeit, deren besondere Kunstfertigkeit und melodiöse Strahlkraft die Jahre überdauern, fast wie Brian Wilsons „teenage symphonies to god“, Phil Spectors prächtige Gerölllawinen und die eleganten Evergreens Burt Bacharachs. (Was übrigens genau das war, was sich die beiden Emporkömmlinge Björn und Benny in den Kopf gesetzt hatten, als sie von 1968 an Ernst machten mit ihrem gemeinschaftlichen Kompositionshandwerk.)
Doch vergessen wir nicht: Als Abba noch lebten und wirkten, waren sie der Feind. Der Feind des Rock, ob breitbeinig, akademisch oder trashig. Der Feind des Anspruchs und der Aufgeklärtheit. Der Feind der Aufbegehrenden, derer mit den umstürzlerischen Gesten wie derer, die tatsächlich eine Gegenkultur in der Popkultur zu etablieren versuchten. Und Abba waren ein ziemlich mächtiger Feind.
Das bekamen zum Beispiel die Mitglieder der schwedischen Progg-Bewegung zu spüren, als sie in den Siebzigern zum Zwecke des kulturellen Austausches eine Exkursion nach Kuba unternahmen. Das vor allem von Folk- und Jazz-Musikern gestützte linke Künstler-Netzwerk hatte sich Ende der 60er-Jahre gegründet. Es sprach sich gegen die Kommerzialisierung von Musik aus, die Selbstermächtigung galt ihr alles. In der allgemein sozialdemokratisch bis sozialistisch geprägten politischen Stimmung in Schweden sollte es ihr tatsächlich gelingen, wichtige Teile des Kulturbetriebs auf ihre Seite zu bringen.
In Abba und in ihrem kontroversen, aufrichtig kapitalistischen Manager Stig Anderson fand sie ihr liebstes Feindbild. Frei nach dem Theoretiker Theodor W. Adorno, der Anfang der Sechziger in seiner „Einführung in die Musiksoziologie“ über „die Schlager“ vorgetragen hatte: „Sie [die Schlager] rechnen mit Unmündigen; solchen, die des Ausdrucks ihrer Emotionen und Erfahrungen nicht mächtig sind; sei es, dass Ausdrucksfähigkeit ihnen überhaupt abgeht, sei es, dass sie unter zivilisatorischen Tabus verkrüppelte. Sie beliefern die zwischen Betrieb und Reproduktion der Arbeitskraft Eingespannten mit Ersatz für Gefühle überhaupt, von denen ihr zeitgemäß revidiertes Ich-Ideal ihnen sagt, sie müssten sie haben.“
Kein Zweifel, Abba waren eine Schlagerband im Sinne Adornos. Sie sangen von Verheißungen: „You can dance, you can jive. Having the time of your life … You are the dancing queen.“ Sie luden zum Träumen ein: „When I know the time is right for me I’ll cross the stream – I have a dream.“ Sie lieferten „Ersatz-Gefühle“.
Aber wie geht die Geschichte von den Progg-Aktivisten, die sich zum Solidaritätsbesuch nach Kuba aufgemacht hatten, denn nun weiter? Nun, selbstverständlich war ihre Freude groß, auf dieser im real existierenden Sozialismus blühenden Insel etwas zu lernen über die Menschen und ihre Kultur. Doch als sie von ihren Gastgebern in Empfang genommen wurden, kannten die nur ein Thema: Sie wollten von ihren schwedischen Genossen alles über Abba wissen. Verdammt, Abba waren einfach überall!
Das Verhältnis zwischen der Band und dem Kulturestablishment in ihrer Heimat sollte sich tatsächlich erst nach ihrer stillen Auflösung bessern. Dass ihnen in ihrer Heimat nichts geschenkt werden würde, dürfte ihnen aber bereits 1974 klar geworden sein, als sie nach ihrem überragenden Sieg beim Eurovision Song Contest in Brighton – es war der erste Triumph für Schweden in diesem Wettbewerb – auf einen Reporter der Nachrichtensendung „Rapport“ trafen. In Anspielung auf ihren Siegertitel „Waterloo“ leitete er sein Interview mit den folgenden Worten ein: „Im vergangenen Jahr habt ihr ein Lied geschrieben über Leute, die miteinander telefonieren. Dieses Jahr habt ihr davon gesungen, wie 40 000 Menschen zu Tode gekommen sind, um es ein wenig zynisch auszudrücken …“
Das Lied mit dem Telefongespräch (welches nicht zustande kommt, das ist ja der Witz!) hieß übrigens „Ring Ring“, war bei der Jury des schwedischen Vorentscheids zum Eurovision Song Contest 1973 durchgefallen und nichtsdestotrotz das rasanteste, gewaltigste, unbedingteste Stück musikalischer Kurzweil, das bis dato aus dem Pop-Entwicklungsland Schweden in die Welt hinausgeschickt worden war. Benny und Björn hatten hierfür mit dem mit großen Forscherdrang ausgestatteten Tontechniker Michael B. Tretow, der für den Rest der Abba-Geschichte nicht mehr von ihrer Seite weichen sollte, nach bestem Wissen und Probieren Phil Spectors „Wall Of Sound“ nachgebaut. Sie spielten alle Gitarren-, Klavier- und Basslinien zweifach ein, legten diese Spuren in minimal voneinander abweichender Laufgeschwindigkeit übereinander, Echoeffekte darüber und ließen die Instrumente so gewissermaßen auf Übergröße wachsen. Auf weiteren Spuren häuften sie das Rasseln von Tambourines, Maracas, Schüttelrohren und Klanghölzern an und polterten vor dem Refrain, den Agnetha und Anni-Frid mit der Energie purer Jugend schmetterten, über die Toms, als wollten sie sich selbst noch anfeuern. So schufen sie einen geradezu dramatischen Sound, der den Stereoraum, den sich der Pop erst ein paar Jahre zuvor wohnlich eingerichtet hatte, auf Kathedralengröße aufriss. Alles war Riff und Klang und diese klaren, glockenhellen Stimmen. „Ring Ring – why don’t you give me a call?“ Hierfür konnte es nur eine Erklärung geben: Der Typ musste taub sein!
Unter Sachkundigen beginnt die Erfolgsgeschichte von Abba mit diesem „Ring Ring“ – und für den Rest der Welt eben 1974 in Brighton, wo die vier nach der damals geltenden Glamrock-Verkleidungsordnung auf Plateausohlen wankend und eingenäht in Bonbonpapier-Kostümen diese stocksteife Schlagerparade aufmischten, vor den Augen von 500 Millionen staunenden Fernsehzuschauern. Um allerdings zu begreifen, wie aus Abba Abba werden konnte, müssen wir uns ihre Vorgeschichte ansehen. Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn hatten bis 1972 nämlich bereits äußerst ereignisreiche Leben gelebt:
Agnetha Fältskog tritt schon im Teenagealter als Sängerin auf, bei Konzerten und Talentwettbewerben. Und sie schreibt eigene Lieder. Ihr Vorbild: Schmonzetten-Prinzessin Connie Francis. Der glücklichste Moment ihrer Karriere: Als sie mit 17 zu ihren ersten Aufnahmen nach Stockholm reist und schon durch die Studiotür erlauscht, wie ein Streicherensemble ein Arrangement ihres Stücks spielt. Als sie 1969 auf ihren künftigen Ehemann Björn Ulvaeus trifft, hat sie bereits eine aufgelöste Verlobung hinter sich und ist in Deutschland als Solostar gescheitert, wird in Schweden jedoch vom Publikum um so mehr geliebt.
Björn Ulvaeus wird mit 18 der Kopf einer braven, erfolgreichen Folkband, die von ihrem Manager und Labelchef Stig Anderson nicht nur den Namen (The Hootenanny Singers), sondern auch den musikalischen Weg vorgegeben bekommt. 1966 lernt der versierte, zielstrebige Mütter-Glücklichmacher den leidenschaftlichen Organisten der Hep Stars, einer Horde amtlicher Töchter-Verrücktmacher, kennen: Benny Andersson. Die Hep Stars gelten in ihrer Heimat als wilde Rockband, sind aber wie die Hootenanny Singers vor allem Interpreten und Übersetzer internationaler Standards und Hits.
Benny Anderssons Elternhaus ist ein Heim für die Volksmusik. Vater und Großvater spielen Akkordeon. Der Junge bringt sich das Tastenspielen selbst bei, bald auch am Klavier. Bei den Hep Stars orgelt er von 1964 bis 1969 – unter anderem auf 20 Top-Ten-Hits. Er ist nicht nur ein nationaler Star, er ist auch schon zweifacher Vater. Benny beginnt mit Björn Songs zu schreiben. Sie ergänzen sich vom ersten Moment an perfekt. Als Stig Anderson Björn fragt, ob er nicht als Hausproduzent bei seinem Label Polar Music einsteigen möchte, macht der zur Bedingung, dass Benny sein Partner wird. Das Duo produziert Rock, Pop, Schlager, Kinderlieder, Big-Band-Jazz, religiöse Musik und lernt dabei sehr viel.
Anni-Frid (später Frida) Lyngstads Karriere in den Sechzigern verläuft weniger erfolgreich. Sie singt mit Bands und Orchestern, ist eher im Jazz- und Evergreens-Fach zu Hause, wo sie sich eine bald über jeden Zweifel erhabene Chanson-Stimme antrainiert (im Gegensatz zu Agnetha übrigens, die live nicht immer alle Töne trifft und sich im Studio mehr abmühen muss). „Im Nachhinein haben Fridas Aufnahmen aus den späten Sechzigern die Jahre besser überstanden als viele der plumpen und langweiligen Balladen, die damals zu Hits wurden“, schreibt Carl Magnus Palm sehr richtig in seiner bibeldicken Abba-Biografie. Nur hat Anni-Frid eben ziemlich lang keinen Hit und steht kurz davor, ihren geliebten Job hinzuschmeißen.
Als Björn und Agnetha und Benny und Anni-Frid schließlich paarweise zusammenfinden (Letztere lernen sich 1968 in einem Restaurant in Malmö kennen), haben zwei eng befreundete Kollegen nun auch zwei attraktive Freundinnen. Und alle vier machen Musik. Doch eine Band haben sie noch nicht. „Wir wohnten nahe beieinander, saßen fast jeden Tag zusammen und machten gemeinsam Urlaub“, erzählt Björn 2005 in einem „SZ“-Interview. „Aber meinen Sie, es wäre uns eingefallen, eine Band zu gründen?“ Benny und Björn nehmen ein gemeinsames Album auf, sie produzieren Songs ihrer Freundinnen, lernen ihre Qualitäten als Background-Sängerinnen schätzen. Doch erst bei einer gemeinsamen Zypern-Reise im Jahr 1970 fällt angeblich der Groschen. Sie haben Gitarren dabei. Musizieren und singen unter der Sonne des Mittelmeers. „Hui, das klingt aber gut! … Und ehrlich gesagt singen die Mädels auch viel besser als wir beide, vielleicht sollten wir ihnen das ganz überlassen.“
Zurück im heimischen Königreich beschließen sie, als Quartett auf Tour zu gehen. Allerdings haben es Livecombos zu dieser Zeit schwer, weil sich die jungen Leute inzwischen lieber in den neu eröffneten Diskotheken tummeln. Die schwedische Bandszene, in der die meisten Musiker ohnehin weit davon entfernt sind, sich als innovative Künstler nach dem großen Vorbild der Beatles zu begreifen, sondern einfach für die Abendunterhaltung zuständig sind, muss sich umorientieren – ein breiteres Publikum gewinnen, in Varietés und Hotels auftreten, noch mehr Coverversionen spielen, Abwechslung bieten. Und genau das tun Agnetha, Frida, Benny und Björn in ihrer „Festfolk“-Show. Sie treten mit einer Tanzband auf, geben kabarettistische Einlagen, animieren in Mitsingspielchen, schneiden eigene und fremde Stücke kurzweilig zusammen.
Sparen Sie sich die Suche, von diesen Auftritten finden sich keine YouTube-Videos. Ist wohl besser so. Vom ersten TV-Auftritt der Band gibt es jedoch eines, da heißen sie noch gar nicht Abba. In einer Wild-West-Kulisse stehen sie da am Tresen aufgereiht, als Saloon-Damen und Cowboys verkleidet, zünftig den Broadway-Standard „California Here I Come“ zum Besten gebend. Peter Alexander, übernehmen Sie!
Der Mainstream in Schweden ist zu dieser Zeit immer noch – wie auch in Deutschland – in Schlagerhand. Und Abba mittendrin. Aus dieser Tradition stammt die Gruppe und wird ihr auch nie ganz entfliehen können. Da sie sich an allen erdenklichen Stilen und Genres der Unterhaltungsmusik zu schaffen macht, dabei fleißig jedes Klischee bedient, noch den albernsten Fummel drüberzieht, um Aufmerksamkeit zu erheischen, bleiben Abba auf ewig eine Revueband. Und da haben wir noch kein Wort verloren über die mit Zwangsreimen, Internationalismen und manch Törichtem gespickten Englisch-für-Anfänger-Texte der Band – über kleine Ballerinas, Tiger, Cowboys und vor allem jede Menge Herzschmerz. Im besten Fall erzählen sie eine nette, kleine, nichtige Geschichte. Über die Menschen hinter Abba erzählen sie nichts. (Das wird sich im Herbst ihrer Karriere allerdings ändern, wenn ihre eigenen zerrütteten Beziehungen Material für ernsthaftere Lyrics bieten.)
Abba sind kein Künstler-Quartett, das in seinem Inneren schürft oder sich an der Welt reibt, auf dass die Funken sprühen. Abba sind nicht „echt“ im Sinne der romantischen Vorstellung, der Popmusikant habe sich sein Werk von der Seele zu spielen und zu singen. Abba spielen nicht einmal gerne live, obwohl sie ihre opulente Musik auf der Bühne durchaus umzusetzen wissen. Ihre Konzerte werden von Band und Management eher als Promotion-Notwendigkeit angesehen. Sie möchten eigentlich lieber in Ruhe an ihren Songs arbeiten.
Was genau macht diese vier Skandinavier dann aber zu „Helden“? Ganz einfach: Alles, was sich gegen Abba vorbringen lässt, wird von ihrer Musik um ein Vielfaches überragt. Sie setzt sich gegen alle Widerstände durch. Abgekoppelt von irgendeiner relevanten Szene, komponiert mit großem Enthusiasmus auf einer winzigen Insel in der Ostsee, arrangiert und eingespielt mit großartigen Studiomusikern, deren Namen in London oder Los Angeles keiner je gehört hat, produziert mit dem Ziel, den edelsten Veröffentlichungen der Bee Gees über Fleetwood Mac bis hin zu Pink Floyd das Wasser zu reichen, stehen Songtitel wie „Dancing Queen“, „SOS“ und „The Name Of The Game“ auch über 30 Jahre später noch mit für die beste Popmusik, die je geschaffen wurde. Auch wenn Stig Andersons unorthodoxe Labelpolitik erst dafür sorgte, dass die ganze Welt diese Lieder kennenlernen durfte, darf man glauben, dass es auf Dauer wohl fast schwieriger geworden wäre, zu verhindern, dass Abba Hits hat.
Musiktheoretiker wie auch die unzähligen ehrfürchtigen Künstlerkollegen, die heute ganz offen über ihre Abba-Verehrung sprechen, referieren sich auf Stichwort gerne den Mund darüber fusselig, welcher Reichtum den meisten Kompositionen Abbas innewohnt. In einem Meisterwerk wie „Dancing Queen“ verstecken sich mehr Melodielinien als auf einer LP-Seite einer durchschnittlichen Madonna-Platte. Obendrein scheint jede dieser Linien die andere noch zu feiern. Und alles kulminiert schließlich in einem dieser einmaligen „Doppel-AA“-Gesang-Refrains, die gerade deshalb so hell strahlen, weil sie sich nach dorthin ausstrecken, wo Euphorie und Melancholie sich überschneiden. Die große Kunst des Pop steckt aber darin, diese Komplexität nicht in den Vordergrund zu stellen – anders als zum Beispiel im protzigen Progressive Rock, dessen Verfechter nur Hohn für die scheinbar seichten Schweden übrig hatten. Du kannst zu „Dancing Queen“ auch einfach nur tanzen und jiven, „die Zeit deines Lebens“ genießen, ohne einen Schimmer von der Tiefe der Komposition oder der Produktion zu haben oder dir Gedanken darüber zu machen, warum der verhexte Groove dieses Stücks so an deinen Hosenbeinen zerrt.
Fragt man Björn Ulvaeus nach dem Geheimnis von Abba, sagt er: Es sei ihnen darum gegangen, die perfekte Melodie zu finden, die „Essenz“, wie er es nennt, vor der „Drachenhöhle“ zu sitzen und auszuharren, und die so entstandenen Ideen akribisch und wenn es sein muss in immer neuen Versuchen und Variationen auszuarbeiten. „Wir waren zwanghaft perfektionistisch. Heute geben sich Musiker ja schon zufrieden, wenn sie einen guten Refrain haben. Wir plagten uns so lange, bis der Refrain und alle Strophen sehr gut waren.“ Kritiker, die Abba unterstellen, sie wären zu analytisch und „berechnend“ vorgegangen, mögen sich in einer solchen Aussage bestätigt fühlen. Aber was glauben sie eigentlich, wie große Kunst entsteht?
Wer unbedingt ein „Geheimnis“ braucht, findet es bei Abba aber ja vielleicht in den Stimmen von Agnetha und Frida und ihrem betörenden Zweiklang. Michael B. Tretow beschrieb dieses Zusammenspiel einmal in Tontechniker-Worten, die dem Ereignis wohl gar nicht gerecht werden können: „Die Stimmen passten einfach perfekt zusammen. Agnetha war sehr punchy und Frida hatte diese Hi-Fi-Qualität – hell und gleichzeitig weich und bassig.“ Björn und Benny wussten auf jeden Fall sehr genau, welche Kräfte sich hier bündeln ließen. Sie trieben die Mädchen immer weiter die Tonleitern hinauf, ließen sie Chöre für jede Strophe, jede Bridge und jeden Refrain singen und dann gleich noch ein paar Harmonien dazu improvisieren, bis sie all diese Spuren so zusammenschneiden konnten, dass die Pracht nur noch so knackte und krachte. So viel auch zur Frage, wer wichtiger war bei Abba: die As oder die Bs? Die simple Antwort kann nur lauten: ohne die As und ohne die Bs kein Abba.
Die Scheidungen der beiden AB-Ehen mit all ihren vorausgegangenen und folgenden atmosphärischen Störungen innerhalb der Band, der Druck, den der weltweite Erfolg und die Hatz mit sich brachten, diesen immer weiter sichern und ausbauen zu müssen, und letztlich die Gewissheit, dass dem Werk nichts mehr Essenzielles, keine „Essenzen“ mehr hinzufügen sind, bringt 1982 das Ende von Abba. Es wird nie offiziell verkündet, aber es gibt auch ohne Erklärung kein Zurück mehr.
Im Jahr 2000 bietet ein amerikanisch-britisches Konsortium Abba eine Milliarde Dollar für eine Reunion-Tour mit 100 Konzerten um die ganze Welt. Die vier bekommen viele Angebote wie diese, aber über ein so hoch dotiertes müssen sie doch etwas länger nachdenken. Dennoch sagt Björn Ulvaeus ab. Er begründet dies so: „Popmusik ist für die Jugend, und diese Phase haben wir alle schon längst hinter uns.“ Man würde sich wünschen, Absagen wie diese viel öfter zu lesen. Vielleicht hätte so ein Statement ja sogar den Progg-Aktivisten aus den Siebzigern gefallen. Heute klingt es tatsächlich fast schon nach einer schönen Utopie.
Empfohlen
Arrival (1976)
Das Songwriting von Benny und Björn hat noch einmal einen Riesensprung gemacht, auf diesem Album gibt es fast nur 1-A-Material (herausragend: „Dancing Queen“, natürlich). Vor allem die Chorarrangements von Songs wie „When I Kissed The Teacher“ und „Knowing Me, Knowing You“ sind bestechend. Die Produktion hält die Songsammlung als Album zusammen.
The Album (1977)
Das zweite Album aus der Zeit der nicht enden wollenden Hits. „Eagle“ orientiert sich an Pink Floyd und Mike Oldfield, „The Name Of The Game“ zeigt, was die Skandinavier mit Funk anstellen können. Am Ende steht das Minimusical „The Girl With The Golden Hair“. Inhaltlich dünn, aber mit „Thank You For The Music“: Killerballade.
The Visitors (1981)
Der Schwanengesang. Die Kälte in ihren Beziehungen wie auch die Bedrohung durch den Kalten Krieg hinterlassen Spuren. Der synthetische Sound trägt das Seine dazu bei. Zudem werden die Chorarrangements zurück gefahren, um den individualistischen Charakter der Stücke zu unterstreichen. Gleichzeitig ist The Visitors aber auch das geschlossenste Album der Band. Und die Singles „One Of Us“ und „Head Over Heels“ sowie die später der CD-Auflage zugeschlagenen „The Day Before You Came“ und „Under Attack“ gehören zu den besten Songs, die sie je aufgenommen haben.
Abgeraten
Ring Ring (1973)
So wie es kein rundum gelungenes Abba-Album gibt, gibt es auch kein komplett misslungenes. Das Debüt leidet allerdings noch unter einem besonders starken Schlagereinschlag und hangelt sich an den Middle-of-the-road-Klischees seiner Zeit entlang, ohne groß eigene Pointen zu setzen.
Waterloo (1974)
Wie auf dem Vorgänger sticht die namensgebende Single auch aus diesem Album heraus. Abba versuchen sich an albernen Reggae- und Glamrock-Stücken. Der trockene, unterschwellige Funk von „My Mama Said“ wirkt allerdings. Das lasziv gemeinte „Honey Honey“ ist hingegen um so biederer.
Bekannte Tribute-/Cover-Bands
A-Teens
Schweden
Abbacadabra
UK
Adbacadabra
USA
Abbaesque
Irland
Arrival From Sweden
Schweden
Björn Again
Australien
Babba
Australien
Gabba
Abba/Ramones-Tribute,
UK
Die besten Coverversionen
1. Lush „Hey Hey Helen“
2. The Czars „Angel Eyes“
3. Camera Obscura „Super Trouper“
4. Garageland „Dancing Queen“
5. Madonna „Like An Angel Passing Through My Room“ (aufgenommen mit William Orbit für Music, jedoch nicht veröffentlicht – 2008 geleaked)
6. Evan Dando „Knowing Me, Knowing You“
7. Susanna (And The Magical Orchestra) „Lay All Your Love On Me“
8. The Real Tuesday Weld „The Day Before You Came“
In den Charts
No.-1-Alben
Deutschland: 4
UK: 5
Schweden: 7
USA: 0
No.-1-Singles
Deutschland: 9
UK: 9
Schweden: 2
USA: 1
inspiriert von
Phil Spector
The Beach Boys
Bee Gees
Fleetwood Mac
Blue Mink
Giuseppe Verdi
haben inspiriert
Madonna
The Ark
Gossip
Cocteau Twins
Elvis Costello
Stephin Merritt (The Magnetic Fields)
Abba und die Folgen
* Abba war die erste Band, die Musik-videos als regelmäßiges Promotion-Tool einsetzte, um damit auf der ganzen Welt präsent zu sein. Regisseur fast aller Abba-Videos: Lasse Hallström, später mit Filmen wie „Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa“ und „Lachsfischen im Jemen“ erfolgreich.
* Im Mai 1978 eröffneten die von Björn Ulvaeus und Benny Andersson gegründeten Polar Studios, in denen bis 2004 Musik produziert wurde. Zu den ersten Gästen zählte die zweite große Band der Siebziger, Led Zeppelin. Sie nahm dort 1979 ihr achtes Album, In Through The Out Door, auf.
* Abbas letztes Album, The Visitors, war (neben einer gleichzeitig veröffentlichten Platte mit Chopin-Interpretationen) im August 1982 das erste Album, das als Audio-CD veröffentlicht wurde.
* Mit der EP „Abba-esque“ des Synthiepop-Duos Erasure begann 1992 das erste große Abba-Revival. Die vier Coverversionen waren eine ironische Verbeugung vor dem Werk der Schweden – nicht zuletzt der gay culture, in der Abba schon seit den Siebzigern verehrt werden.
* In dem tragisch-komischen Film „Muriels Hochzeit“ von 1994 wird die ganz besondere, zuweilen hysterische Beziehung Australiens zu Abba thematisiert; personifiziert in der Hauptfigur Muriel Heslop (Toni Collette), die zu den Klängen und Texten von ihrer Märchenhochzeit träumt.
* Abba werden heute als zweiterfolgreichste Band hinter den Beatles angesehen, ihr jährlicher Tonträgerverkauf auf zwei bis drei Millionen pro Jahr geschätzt. Das einstige Pop-Entwicklungsland Schweden ist inzwischen der drittwichtigste Produzent von Popmusik weltweit.
Was die Anderen über Abba sagen
„Ich war ja auch einer von diesen Künstler-Snobs: Tatsächlich mochte ich die Songs von Abba sehr, aber gleichzeitig konnte ich mir das auch nicht durchgehen lassen.“
Brian Eno
„Ich liebe Abba. Hör dir diese Lieder an – sie sind unfassbar!“
Noel Gallagher
„Abba haben einen nie hängen lassen. Auch wenn sie zuletzt vielleicht ein bisschen festgefahren wirkten, beherrschen sie die Charts seit einer Ewigkeit, und das ist schon bewundernswert … außerdem sind die Mädchen schnuckelig“
Joe Strummer
„Was für großartige Songs! Schreib mal ein Stück wie, Fernando‘! Benny ist außerdem ein erstklassiger Boogie-Pianist. Und dann diese beiden … leckeren Mädchen aus dem schwedischen Märchenwald. Ich bin mir allerdings sicher, dass die beiden keine Ahnung hatten, was sie da für einen Unsinn singen.“
Lemmy Kilmister (Motörhead)
„Es gibt an ihrer Musik nicht eine Ecke oder Kante, einfach unglaublich. Gerade deshalb bin ich wohl auch so vernarrt in sie, weil ihre Songs so anders sind als alles, was ich normalerweise höre.“
Beth Ditto (Gossip)
Im nächsten Heft: ME-Helden, Teil 19 – curtis mayfield