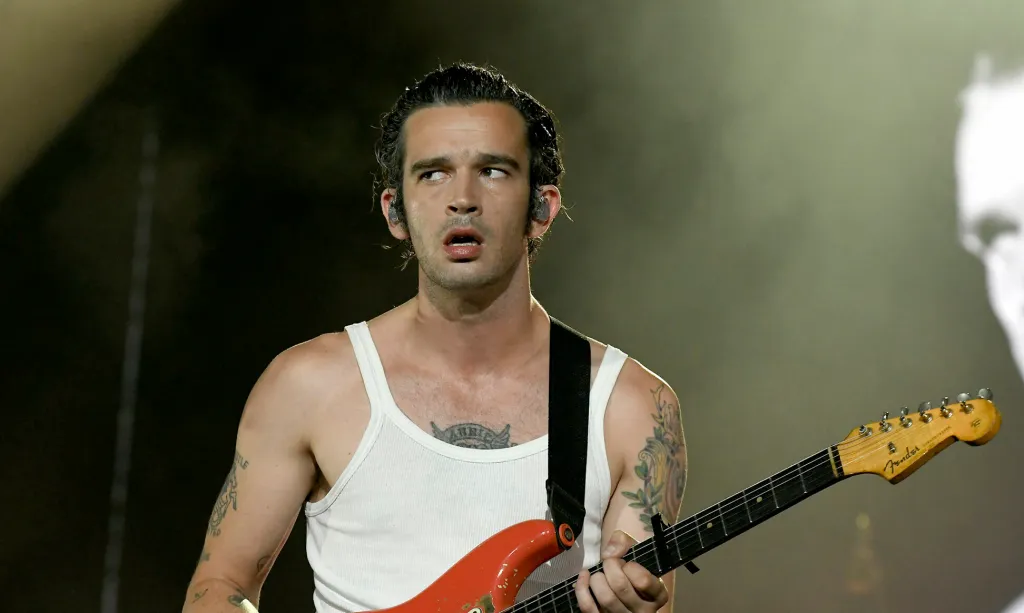Elliot Tiber über „Taking Woodstock“
Sein Roman „Taking Woodstock“ kommt in der Verfilmung von Oscar-Preisträger Ang Lee in die Kinos. ME-Kinoexperte Tomasso Schultze sprach mit Autor Elliot Tiber.
Tibers Roman „Taking Wodstock“ wird am 3. September in der Verfilmung von Oscar-Preisträger Ang Lee auf die Leinwand kommen. MUSIKEXPRESS-Kinoexperte Tomasso Schultze sprach mit Woodstock-Initiator Elliot Tiber über dessen Erinnerungen an das legendäre Open Air.
Warum haben Sie „Taking Woodstock“ geschrieben?
40 Jahre sind vergangen, aber es war eine so profunde Erfahrung, dass ich sie bis heute nicht abschütteln kann, Deshalb musste ich „Taking Woodstock“ schreiben. Es musste einfach raus.
Warum trugen Sie Ihre Erlebnisse so lange mit sich herum?
Ich habe mit dem Buch tatsächlich schon vor etwa neun Jahren begonnen. Kein Verleger zeigte Interesse. Also habe ich es noch einmal überarbeitet. Diesmal biss ein Verlag an, aber ich musste das 1000-seitige Manuskript noch einmal massiv kürzen. Das nahm einfach etwas Zeit in Anspruch. Mir war es wichtig, Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, die sich über all die Jahre gehalten hatten. Ich wurde im Lauf der Jahre immer wieder zu Woodstock befragt, bei allen möglichen Jubiläen, aber immer wenn ich erwähnt oder zitiert wurde, ließ man tunlichst unter den Tisch fallen, dass ich ein schwuler Mann bin. Sie schreiben, dass Woodstock ohne mich nicht passiert wäre, aber sie ignorieren, dass man das Festival ohne Hilfe eines schwulen Mannes niemals hätte abhalten können. Ich kann es nicht beweisen, aber welchen anderen Grund als Homophobie kann es dafür geben?
Aber Ihnen ist das wichtig.
Meine Sexualität ist einer der Gründe, warum ich den Schritt unternommen habe, die Erlaubnis für das Festival in Bethel zu beantragen. Nachdem die Veranstalter in einer Reihe anderer Städte abgeblitzt waren, nahm ich Kontakt zu ihnen auf. Ich hatte als Vorsitzender der Handelskammer von Bethel die Befugnis, ein Musikfestival im Jahr auszurichten. Die Jahre davor war das immer eine kleine lokale Angelegenheit gewesen, zu der vielleicht ein Dutzend Leute erschienen, unter ihnen Max Yasgur, mein Milchmann, auf dessen Farmgelände Woodstock schließlich stattfand. Aber nur, weil der Landbesitz meiner Familie, ein Stück Sumpf, nicht geeignet war. Sie wollten schon wieder abziehen, da hatte ich den rettenden Einfall: Ich habe Mike Lang schließlich mit Max bekannt gemacht und ihm sein Land gezeigt: 1000 Hektar mit nichts als Gras und Kühen – und die konnten ja Platz machen. Es war meine Pflicht als Präsident der Handelskammer, für Handel zu sorgen. Die Stadt war pleite, also habe ich das Festival ermöglicht.
Es ist faszinierend, dass Stonewall, also die Anfänge der Schwulenbewegung, für Sie untrennbar mit Woodstock verbunden sind.
Ich hätte sonst nie den Mut gehabt, mich gegen die Bullen zur Wehr zu setzen. In Bethel, wo meine Eltern mehr schlecht als recht ein Motel leiteten, das immer kurz vor der Schließung stand, wusste niemand von meiner Sexualität. Aber ich lebte ein Doppelleben: In New York, wo ich ein etabliertes Mitglied in der Kunstszene war, lebte ich meine Homosexualität aus. Mit meinen Freunden traf ich mich abends in den einschlägigen Clubs, die eigentlich verboten waren und sich ständigem Ärger mit der Polizei ausgesetzt sahen. Ich war also an jenem 24. Juni in der Christopher Street, in Stonewall, als wir die Nase voll hatten, ständig drangsaliert zu werden. Wenn ich nicht ein paar Wochen vorher den todesmutigen Schritt unternommen hätte, Woodstock nach Bethel zu holen – was ein Wahnsinn war! – hätte ich mich niemals getraut, mit sieben oder acht Freunden meine Faust gegen die Cops zu erheben. Genug war genug. Es war eine logische Folge. Sie sehen, wie nachhaltig Woodstock mein Leben bereits veränderte, bevor es überhaupt stattgefunden hatte.
In Woodstock selbst spielte sexuelle Orientierung keine Rolle.
Es war der eine Moment in der amerikanischen Geschichte, wo es egal war, ob man Männer oder Frauen liebte. Es war der eine Moment der Utopie, der absoluten Freiheit, der absoluten Befreiung. Wo man hinblickte, liebten sich die Menschen. Sex war überall, in jedem Gebüsch, hinter jedem Baum, im See. Es war großartig. Die Menschen wurden als das akzeptiert, was sie waren, wie sie waren. Unser Motel, in dem ich auch eine Bar und Disco betrieb, war einer der Treffpunkte. Ich konnte dieses unglaubliche Gefühl, einfach ausleben zu können, wer man ist, hautnah miterleben. Es war eine große Party ohne Gewalt, die Kulmination dessen, was in San Francisco mit dem Summer of Love begann.
Klingt klasse.
War auch klasse. Wenn man mir Jahre später sagte, ich solle mich nicht Zuhause einigeln und mehr auf Partys gehen, sagte ich immer nur: Leute, erzählt mir nichts über Partys. Ich habe die größte Party aller Zeiten geschmissen. Ich weiß, was abgeht.
Die Ironie war, dass Sie, der Woodstock überhaupt erst möglich machte, vom Konzert selbst nichts mitbekommen haben.
Richtig. Das Konzert fand etwa sechs Kilometer von unserem Motel entfernt statt. Weil ich meine alten, gebrechlichen Eltern unterstützen musste, konnte ich einfach nicht weg. Mike Lang hatte das Motel als Hauptquartier angemietet, also war ohnehin viel los. Aber außerdem kamen und gingen unentwegt Menschen, die Richtung Woodstock pilgerten. Es waren 18.000 Menschen auf unseren 15 Hektar Land. Wir hatten ein regelrechtes mobiles Einsatzkommando am Laufen: Kids hatten schlechte Drogentrips, andere waren in Scherben getreten und mussten behandelt werden. Ich habe sogar ein Baby auf die Welt gebracht. Ich kam einfach nicht weg. Aber weil direkt nebenan ein See war, wurde der Schall gut getragen. Und wir konnten das komplette Festival mitverfolgen.
Was gefiel Ihnen am besten?
Richie Havens war der erste Act. Als er „Freedom“ spielte, ging mir ein Licht auf und mir wurde mit einem Schlag bewusst: Klar, darum geht’s – und um nichts anderes. Ich traf viele der Künstler, sie schauten einfach bei uns vorbei. Viele von ihnen wurden auch bei uns untergebracht – das war eine Zeit, in der Musiker noch nicht in Wohnwägen oder Bussen schliefen. Richie Havens ist bis heute ein guter Freund. Janis Joplin war großartig. Ich durfte sie einmal in den Armen halten, bevor sie starb. Cannes Heat, Joe Cocker und Jimi Hendrix habe ich noch gut in Erinnerung. Jimi habe ich später noch einmal getroffen, als er nach Belgien zog, kurz vor seinem Tod. Ich war zu diesem Zeitpunkt bereits nach Europa übergesiedelt und besuchte ihn. Er sah elend aus.
War Ihnen bewusst, dass Woodstock nicht das erhoffte Versprechen sein würde, sondern der Höhepunkt, nach dem es dann unweigerlich bergab gehen musste?
Wir empfanden es einfach als Party. Nicht mehr, nicht weniger. Dass es ein historischer Moment war, das wird einem doch immer erst rückblickend bewusst. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich eines Tages ein Buch darüber schreiben würde, dass man mit mir 40 Jahre danach noch darüber sprechen wollen würde, dass ich eine Ikone werden würde. Ich habe einfach mein Leben weitergeführt, bin nach Belgien gezogen. Da hat das niemand interessiert. Woodstock? Das Drogenfestival? Erst bei meiner Rückkehr nach Amerika wurde mir klar, welche Bedeutung diese drei Tage gehabt, welch bleibenden Eindruck sie hinterlassen hatten.
Warum Woodstock? Warum nicht Monterey oder Altamont oder ein anderes Festival?
Es lag in der Luft. Anders kann ich es nicht beschreiben. Wir protestierten gegen Vietnam, gerade war der erste Mensch auf dem Mond gelandet. Es war alles etwas surreal. Im Film sieht man ganz am Schluss den Mann, der die Toiletten reinigt. Er wird gefragt, was er von all dem Dreck hält. Und er antwortet: Ein Sohn von mir ist hier auf dem Festival und liegt in der Pampe, mein anderer Sohn ist in Vietnam und liegt dort in der Pampe (stockt und fängt an zu weinen). Was würden Sie wählen? Mehr muss man nicht sagen. Mehr kann ich gerade auch nicht sagen (ist immer noch überwältigt von seinen Gefühlen).
Für Sie ist Woodstock auch mit viel Schmerz verbunden…
Es war ein Lichtblick in einer eigentlich sehr schrecklichen Zeit. Aber ich fühlte mich lange Zeit auch ausgeschlossen. Alle möglichen Leute wurden dafür gefeiert, nur ich wurde aus der Sache herausgehalten. Das tat weh. Das hat sich geändert. Mittlerweile weiß man auch, wer ich bin, was ich gemacht habe. Und dass man einen Film aus meiner Erfahrung gemacht hat, kommt mir immer noch wie ein Traum vor. Ich hatte ein paar schwere Zeiten zu überstehen, aber wenn das nötig war, um an dem Punkt anzukommen, an dem ich mich jetzt befinde, dann war es das wert.
Tomasso Schultze – 12.08.2009