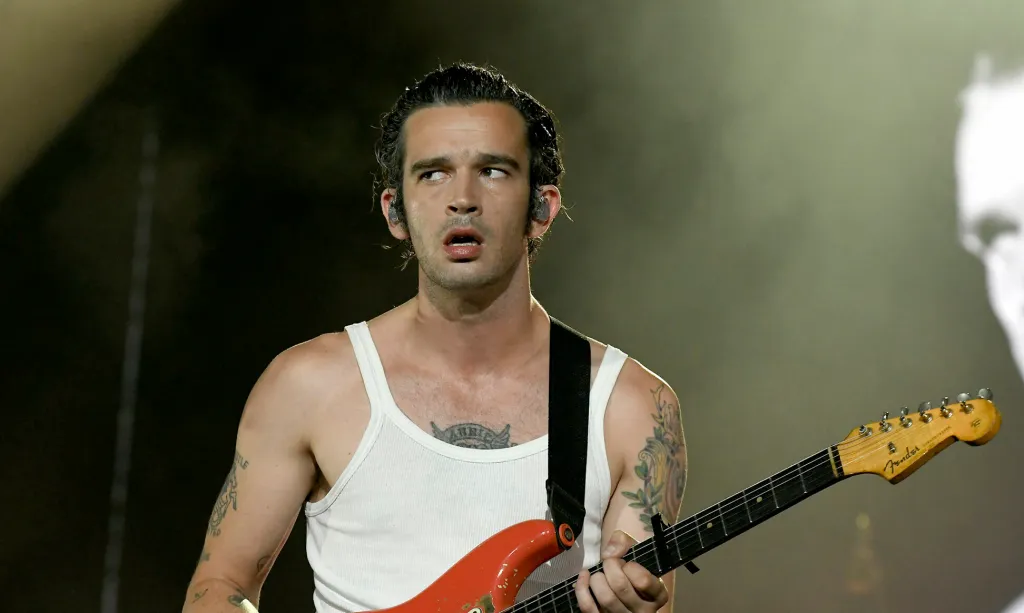KONZERTE
WARPAINT
MAIFELD DERBY, MANNHEIM
Warpaint machen vieles richtig. Das Festival-Publikum in Mannheim bleibt dennoch auf Distanz.
Es ist Abend am zweiten Tag des Maifeld Derbys, und nach einem überraschend schwülen Nachmittag hat sich die Wärme im Palastzelt gesammelt. Während draußen die Mighty Oaks ihren Auftritt beenden, wird es um die nebelumhüllte Bühne im Zelt immer voller. Als der Auftritt von Warpaint beginnt, wirft die Bühnenbeleuchtung türkisfarbenes Licht auf die Instrumente. Schon bei den ersten Tönen schüttelt Bassistin Jenny Lee Lindberg ihr pinkes Haar hin und her. Wenn man am Bühnenrand steht, erkennt man, dass sie mit dem Kopf Zeichen in Richtung des Tontechnikers gibt. Irgendetwas ist der Band zu leise, etwas anderes zu laut. Die Akustik im hohen Zelt ist schwer in den Griff zu bekommen, und die Stimmen sind anfangs etwas kraftlos, aber die analogen wie die digitalen Drums füllen den Raum. Die Songs aus beiden Alben kommen live mit viel mehr Druck und werden von der Band ausufernd zelebriert. Da ist „Hi“ mit seinem treibenden Bass, und „Love Is To Die“ schmachtet sich über die Fünf-Minuten-Grenze hinaus irgendwo Richtung Zeltdecke. Leider wirken die ausladenden Stücke auf das Publikum nicht ganz so intensiv. Nach den ersten Liedern lichten sich die Reihen schon ein wenig, da die flächigen Shoegaze-Stücke es den Gelegenheitshörern nicht einfach machen. Die spärliche Kommunikation mit dem Publikum tut ihr Übriges. Am Ende sind es nur einige Wenige, die mitwippen und nach den letzten Klängen noch ein, zwei Minuten vor der Bühne warten, um zu sehen, ob denn noch etwas passiert. Obwohl Warpaint den Erwartungen gerecht werden, schaffen sie es nicht, die Leute aus ihrer Müdigkeit rauszureißen. Schade um den eigentlich gelungenen Auftritt.
Arne Lehrke
SETLIST
Intro Keep It Healthy Bees Hi Undertow Feeling Alright Biggy Love Is to Die No Way Out Disco//Very Drive Ashes To Ashes Elephants
MACKLE-MORE
HURRICANE FESTIVAL, SCHEESSEL
Hochgearbeitet hat s i c h Macklemore: 2013 noch Nachmittagspausenclown, ziert sein Name 2014 die Rückseite der Festival-Shirts in maximaler Schriftgröße. Fehl am Platz ist er da nicht. Ein Ort, an dem man von Mittvierzigern in Pikachu-Overalls nach dem Weg zur nächsten Bukkake-Party gefragt wird, bietet genug trash-empfänglichen Nährboden für die große Macklemore-Sause. Wenn man nach dem zehnten Bier noch eine Zeile mitsingen kann, dann lautet sie „This is fucking awesome“.
Was man nach dem zehnten Bier aber auch noch merkt: An Macklemores Stärken hat sich genauso wenig geändert wie an seinen Schwächen. Lediglich der Rahmen ist ein anderer, und der lässt vor allem Letztere zu Tage treten. Im Vorjahr gab’s eine Dreiviertelstunde zu füllen, das war mit ein paar Hits und viel sinnlosem, mit etwas Fantasie aber sympathischem Gelaber schnell getan. Die Sonne tat ihr Übriges. Jetzt ist es Mitternacht, der Slot doppelt so lang und Macklemore macht alles falsch, um ihn zu füllen: viel zu spät kommen, etwas zu früh gehen und doppelt so viel reden. Zwischen dem vorletzten und dem letzten Song waren’s – der Autor hat aus Langeweile mitgestoppt -elf Minuten. Das Publikum weiß jetzt, dass Macklemore jede Menge wichtige Songs geschrieben hat, von denen „Same Love“ der wichtigste ist, weil er von Sachen wie equality und so handelt. Und dass Ryan Lewis einer der besten hip-hop-producers in the game right now ist, mit mittlerweile vier Grammys. Und dass Macklemore den Seinen daheim in Seattle gerne erzählen würde, dass das Hurricane mehr gefeiert hat als das Southside. Tja. Alles irgendwo verzeihlich, wären da nicht die aufgeblasenen Streicher und vor allem: Macklemore selbst, der seine Partyhits genau wie die „deepen Tracks“ mit einem Selbstverständnis als Generationensprachrohr performt, das ihm einfach nicht steht, genauso wenig wie die Perücke, die er sich irgendwann aufsetzt. Gerade weil er keine Witzfigur sein will, degradiert sich Macklemore zu einer. Und spielt „Can’t Hold Us“ am Ende zweimal. Ernsthaft jetzt. Ivo Ligeti
NEUTRAL MILK HOTEL
KAMMERSPIELE, MÜNCHEN
Es geht um Musik: Die 90er-Veteranen und ihr Eigenleben nach der Totenstarre. Die einzigen beiden Alben von Neutral Milk Hotel, ON AVERY ISLAND und IN THE AEROPLANE OVER THE SEA erschienen 1996 und 1998. Würde man die Entfernung vom Debütalbum zur aktuellen Wiederauferstehung auf dem Zeitstrahl in die andere Richtung gehen, würde man in einer Ära landen, in der John Lennon noch lebt, die Sex Pistols sich frisch aufgelöst haben und „Saturday Night Fever“ die Welt beherrscht. In ihrem ersten Leben war Jeff Mangums Band ein Geheimtipp, den sich Lo-Fi-Pop-Connaisseure zuflüsterten. Entsprechend verliefen die Tourneen: mit zu vielen Instrumenten in zu kleinen Bussen durch die Gegend fahren, um in zu schäbigen Klubs vor zu wenigen Leuten zu spielen. Ausgebrannt und angestrengt wurde Neutral Milk Hotel auf Eis gelegt und entwickelte erst in der Totenstarre so richtig das Eigenleben, von dem nahezu jede „verkannte“ Band träumt: AEROPLANE verkaufte sich bis heute über 300 000 Mal, und viele deutlich erfolgreichere KünstlerInnen nennen die Band als Einfluss.
Und auf einmal sind sie wieder da, wie ein verlorener Gegenstand, den die Sofaritze eines Tages preisgibt, wenn man längst aufgehört hat sich zu fragen, wo man ihn verloren hat. Der Besonderheit der Rückkehr angemessen findet sie im prachtvollen Theatersaal statt. Die Bühne ist zugestellt mit einem Schrammelsurium aus Vintage-Equipment: Gitarren in Pawnshop-Optik, Dudelsack, zahlreiche Blechblasinstrumente und mehrere (!) singende Sägen und Akkordeons. Das Publikum begrüßt die Band halb wie einen alten Bekannten, halb wie den Heilsbringer der Krachpop-Miniatur. Obwohl die fünf schratigen Typen auf der Bühne fast die komplette AEROPLANE-Originalbesetzung darstellen, fühlt es sich nicht an wie eine rückwärtsgewandte Eigen-Mythisierung für 90s-Nostalgiker, sondern wie Musik, die aus dem Moment heraus passiert, was zum minimalen Licht und dem strengen Foto-und Filmverbot passt: Es geht ausschließlich um Musik und ihre Augenblicklichkeit, nicht um die Inszenierung oder Dokumentation eines Denkmals. Mangums schneidende und zugleich warme Stimme schwebt über dem perfekt orchestrierten rumpelnden Chaos seiner ständig Instrumente wechselnden Mitmusiker, ein Bastard aus Verzerrung, Folk und Barock-Pop, ein wenig als würde man die zu aktiven Zeiten ähnlich verkannten The Zombies im Moment der schönsten Melodie detonieren. Julian Koster als aufgedrehter Sidekick trägt Zipfelmütze und rotiert wild um die eigene Achse, hantiert häufig mit gefühlt sechs Gegenständen gleichzeitig in diesem Sound-Wurzelgeflecht, dessen intuitive und vertrackte Systematik nur die beteiligten Musiker in Gänze durchschauen. Wenn Scott Spillane keines seiner Blasinstrumente an den Lippen hat, singt er inbrünstig und mit bebendem Rauschebart in den Saal hinein jedes Wort mit, zum eigenen Vergnügen. Anders als etwa aktuell bei den Pixies stellt sich nie das schale Gefühl ein, dass der Zahn der Zeit eben doch tüchtig an einer Band genagt hat, Neutral Milk Hotel bleiben so ungewohnt, durchgeknallt und aus der Zeit gefallen wie eh und je, voller Irrsinn, Genialität, Schönheit. Es ist eine wahre Freude.
Björn Sonnenberg
LANA DEL REY
ZITADELLE SPANDAU, BERLIN
Die Königin der Vorstadt: Lana Del Rey lädt zur Selfie-Session in die Spandauer Zitadelle. Das ist so wahnsinnig meta: Eine Kamera filmt Lana Del Rey, während Fans sie mit ihren Mobiltelefonen fotografieren, meistens Wange an Wange. Die Fans sehen das wiederum auf der großen Leinwand hinter der Bühne und beenden sofort das Selfie, weil sie ja der Person neben sich sagen müssen, dass sie eben da in den Spandauer Abend hinausgestrahlt wurden. Bis hinten am Schlemmertaschen-Stand leuchten die begeisterten Gesichter. Väter, Mütter, Kinder, da kullern schon während des Openers „Cola“ erste Tränen.
Wer Lana-Del-Rey-Fan ist, der wirft sich total rein in seine Begeisterung. Das passt sehr gut, weil auch die Musik von Lana Del Rey intensiv ist. Da werden alle emotionalen Regler auf maximalen Anschlag gedreht und die großen Themen der Zwischenmenschlichkeit verhandelt, und zwar mit einer hollywoodmäßigen Dramatik, die die Gegenwart plötzlich total vintage wirken lässt oder eher: retro. Die Musik verhält sich zu der von sagen wir mal Roy Orbison wie der neue Fiat 500 zum Entwurf von 1957. Das soll kein Vorwurf sein, denn vor allem fällt in der Zitadelle Spandau auf: Lana Del Rey bevorratet ausschließlich Hitmaterial. „Born To Die“,“Ride“,“Blue Jeans“,“West Coast“ als Hinweis auf das ansonsten größtenteils ignorierte neue Album ULTRAVIOLENCE oder „National Anthem“, das in eine Endlosversion seiner selbst übergeht und das Konzert eine Spur zu früh beendet: Ob diese Songs jetzt besser sind oder die Sängerin, volksnah wie eine gütige Königin und gleichzeitig überhaupt nicht zu greifen, das soll bitte mal jemand eingehend untersuchen, vielleicht im Rahmen einer Promotion. Jochen Overbeck
SLOWDIVE
PRIMAVERA SOUND 2014, PORTO
Lächeln vor einer fantastischen Kulisse: Slowdive laden in Portugal zur großen Reunion zwischen Meer und Eukalyp tusbäumen. Rechts liegt der Atlantik, der bedrohliche Wolkenmassen über den Parque da Cidade jagt. Zu schnell, um sich entleeren zu können an diesem sehr kühlen Abend. Aber es hätte auch Eiswürfel regnen können, Slowdive hätten sie mit ihren betörenden Klängen wohl einfach verdampfen lassen.
Zwanzig Jahre nach ihrem letzten Konzert und der anschließenden Auflösung kam die mit wichtigste Band des Shoegazing und Dream Pop extra für das Primavera Sound Festival 2014 zusammen, das seit einigen Jahren neben Barcelona in kleinerer Form auch in Porto stattfindet. Etwas außerhalb der Stadt liegt das hügelige und bewaldete Parkgelände, man riecht die Eukalyptusbäume und das Meer, die Sicht auf die in die Landschaft eingebetteten Bühnen ist traumhaft. Es war also alles bereitet für einen großen Abend, und obwohl Slowdive vorab erst ein paar Shows gaben, spielten sie auf, als wären sie nie entschwunden gewesen. Alles gelingt den Briten um Songwriter, Gitarrist und Sänger Neil Halstead vor einem etwas reservierten, jedoch aufmerksamen, herzlichen und generationsübergreifenden Publikum, das sich kollektiv von den betörenden Arrangements der Briten mittreiben lässt, in ihnen versinkt. Die immer noch bezaubernde Sängerin Rachel Goswell legt ein Dauergrinsen auf ob dieser Atmosphäre, haucht ihren verhuschten Gesang ins Mikro, wo sich die nicht dechiffrierbaren Textzeilen auf dem Weg zu den Lautsprechern in flüchtige Sounds verwandeln. Die mischen sich dann unter in die schwebenden, sublimen Klänge der durch unzählige Effekte, Hall und Loops manipulierten Gitarrenriffs, die zwischen kristallener Klarheit und Verzerrung oszillieren. Der Verfremdungsprozess geht so weit, dass man sich fragt, wo das britische Quintett die Keyboards auf der Bühne versteckt haben mag.
Slowdive spielen alle Stücke, die sie zum zeitlosen Pop- Phänomen machten, für die so lieb gewonnen wurden: die Semi-Pop-Lieder „Alison“ und „Machine Gun“, das ätherische „Avalyn“ und das entrückte „Souvlaki Space Station“ und natürlich die Dream-Pop-Hymne „When The Sun Hits“. Keine Minute von all dem klingt nostalgisch oder rückwärtsgewandt. Die jungen Menschen, die parallel zur Entstehung von Slowdive geboren wurden, erliegen so dem Zauber einer Gruppe, die sich mit einem atemberaubenden Auftritt zurück meldet. Für die andere Hälfte des Publikums war es ein vor Kurzem noch unerwartetes Wiedersehen, dass einem die Augen feucht wurden.
Sven Niechziol