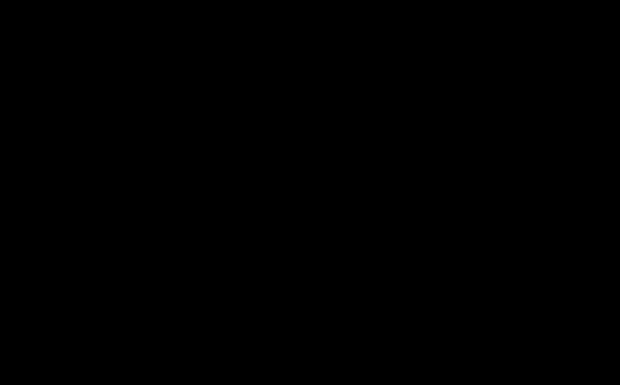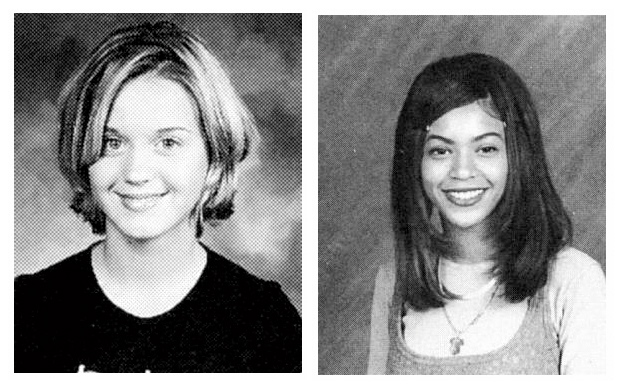Studie zeigt: Gothic-Teenies haben dreifach erhöhtes Depressionsrisiko
Das überrascht dann doch: Britische Forscher wiesen einen Zusammenhang von Goth-Subkultur und Depri-Risiko nach.
Um gleich zu Beginn mit Klischees zu spielen: Geahnt hat man ja immer irgendwie, dass die Gothic-Kids mit ihrem dauermelancholischen Blick, dem Hang zu dunklen Outfits und noch dunklerem Liedgut ein bisschen depri sein müssen, bei all den Schattenseiten des Lebens die ihnen Look und Musikgeschmack da offerieren. Dass es nun bewiesenermaßen eine Korrelation zwischen Goth-Mucke-hörenden Teenagern und deren Anfälligkeit für Depression gibt, kommt dann aber doch recht überraschend.
Eine Studie der Oxford Universität hat nun herausgefunden, dass 15-jährige Teenager, die in der Gothic-Subkultur beheimatet sind, ein dreifach höheres Risiko für Depression aufweisen, als ihre gleichaltrigen Mitprobanden ohne diesen Musikgeschmack und den Zugang zur Subkultur. Auch das Risiko, sich selbst zu verletzen, sei bei ihnen fünfach höher.
Das Team um Forscherin Dr. Lucy Bowes nutzte für ihre Studie die Daten von 3700 Teenagern, die in einem Zeitraum von etwa drei Jahren ihre Erfahrungen vom 15. bis 18. Lebensjahr beschreiben sollten, in Bezug auf depressive Gedanken, den Wunsch nach Selbstverletzung und den Zusammenhang zu ihrer Zugehörigkeit zu einer Subkultur. „Unsere Studie soll nicht beweisen, dass Goth-Musik dazu anstiftet, depressiv oder selbstverletzend zu werden, doch sie zeigt, dass einige Gothic-Teens anfälliger für diese Konditionen sind als andere“, erklärte Bowes auf der Uni-Website.
Teenager, die sich in der Studie selbst als „sportlich“ beschrieben, tragen hingegen das geringste Risiko für Depression und Selbstverletzung. Jugendliche, die sich hingegen als „Skater“ bezeichnen, seien ebenfalls anfälliger für depressive Gedanken. Doch die am stärksten herausstechende Gruppe sei zweifelsfrei die der „Goths“ gewesen.
Das Ziel ihrer Studie sei laut dem Forscher-Team, dass ihre Ergebnisse dazu beitragen sollen, Wege aufzuzeigen, schon früh in der Prävention für Depression und ähnliches bei entsprechend anfälligen Jugendlichen anzusetzen. Aber auch, um für dieses Thema das Umfeld und die Betroffenen zu sensibilisieren und einen Anreiz zu schaffen, sich Hilfe zu holen, wenn Jugendliche merken, dass bestimmte Symptome auf sie zutreffen.