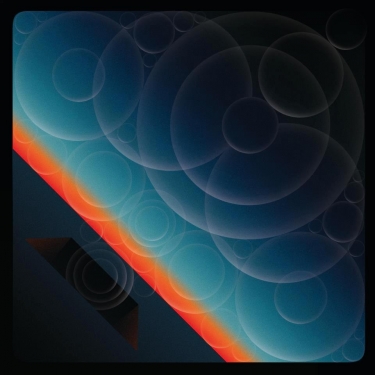The Mars Volta
Noctourniquet
Warner VÖ: 23.3.
Die Post-Progger und Meta-Punks geben sich auf ihrem sechsten Studioalbum transparent und zugänglich wie nie.
Omar Rodriguez-Lopez und Cedric Bixler-Zavala verdanken wir die aufregendste, wagemutigste und forderndste Rockmusik der 00er-Jahre. Keine leichte Kost, ist aber so. De-Loused In The Comatorium, Frances The Mute, Amputechture, Octahedron sind weniger Alben im klassischen Sinn als vielmehr Einübungen in die Überforderung. An einem Stück bis zum Ende durch hört man sie aus demselben Grund, der auch den Alpinisten auf die Berge treibt: „ Weil sie da sind.“ Hypernervöse Rhythmuswechsel, 5/8- oder 6/8-Takte und bis zu halbstündige Songsuiten mit römisch bezifferten Untertiteln nähren das hartnäckige Missverständnis, hier handele es sich um Prog Rock. In dieser an selbstverliebter Bräsigkeit kaum zu überbietenden Szene allerdings, in der schlafmützige Epigonen immer wieder die großen Momente von Genesis und Pink Floyd nachstellen, sorgten The Mars Volta eher für Kopfschütteln.
Mit dem Mehltau der Vergangenheit und dem traurigen Handwerk des künstlerischen Reenactments also haben sie nichts zu schaffen. Eher schon treiben sie, wie weiland Queen mit ihrem Bubblegum-Prog-Meisterwerk „Bohemian Rhapsody“, gewisse Stilmerkmale mutwillig auf die Spitze. Nicht aus Jux, sondern als Belastungstest. „In Absentia“ beispielsweise ist ein Gleiten, ein Wegrutschen, ein Verwischen. Fast fünf Minuten lang nichts, woran man sich festhalten könnte, als liefen drei Songs gleichzeitig, als setze die Band immer wieder an, so etwas wie einen Song zu finden in diesen ineinander verkeilten Melodietrümmern. Nur wer sich diesem durchaus nervtötenden Hörerlebnis stellt, wird am Ende aber mit einer musikalischen Auflösung belohnt, die an harmonischer Wucht kaum zu übertreffen ist.
Mit Punk, dem anderen Pol ihrer Musik, verbindet The Mars Volta lediglich der Hang zum sinnlosen Walten roher Kräfte. Nur geschieht das hier immer virtuos, nie dilettantisch. Und das, obwohl auf Noctourniquet erstmals der ganze verschwenderische Fuhrpark aus Flöten, Congas, Harfen, Holz- und Blechbläsern, Xylofonen komplett ausgeräumt ist. Das Üppige weicht einem elektronischen Minimalismus. Kaum eine Minute vergeht, in der es nicht wie in der Spielhalle klingelingelingt, zwitschert, zirpt, blubbert, pluckert, knistert, ächzt oder summt, wie wenn sich bei „Star Wars“ die Lichtschwerter kreuzen. Und wenn manchmal dezent der Dub durchklingt, dann wärmt das sozusagen den Innenraum der Musik. Ein Album wie Bedlam In Goliath mit seinen nahöstlichen Bezügen, den Fieldrecordings und der byzantinischen Tonart war wesentlich wärmer, fast schwül. Hier nun herrscht eine Kälte, die seltsamerweise nicht seelenloser, sondern erfrischender wirkt. Gestrafft, auch weil nur ein einziger Song die Marke von sieben Minuten überschreitet.
Wo früher exquisite Maßlosigkeit und hibbeliger Irrsin herrschte, obwaltet plötzlich pure Präzision und effektsichere Beschränkung auf das Wesentliche. Nackter hörte man The Mars Volta nie, und so kommen ihre musikalischen Muskelpakete noch besser zur Geltung. Was diesmal vor allem Deantoni Parks zu verdanken ist, dessen Schlagzeugspiel trotz seiner besessenen Frickeligkeit an das von John Bonham selig erinnert. In „Aegis“ klingt er sogar wie der Drumcomputer von Radiohead. Zwar hat es auch hier beschleunigte und rückwärts laufende Instrumentalpassagen oder exotische Stimmaufnahmen, doch halten sich diese Experimente ebenso im Rahmen wie Ausflüge in den Freejazz. Selbst die E-Gitarrensoli lassen sich an den Fingern einer Hand abzählen. Trotzdem – oder deshalb – bietet Noctourniquet eine Vielfalt, wie sie selbst für die Verhältnisse von The Mars Volta außergewöhnlich ist. Nach genau 84 Sekunden überrollt das einleitende „The Whip Hand“ den Hörer mit einem klanglichen Fausthieb in die Magengrube, wie man es zum Beispiel vom Dubstep kennt. „The Malkin Jewel“ stolpert über einen wuchtigen Offbeat nach vorne, immer kurz vor dem Fall, wobei Bixler-Zavala mit seiner athletischen Stimme zur Abwechslung mal in tiefsten Tiefen gründelt und grummelt.
Angeblich „handelt“ auch Noctourniquet von irgendwas, dem Mythos des Hyazinth, dem Superman-Gegenspieler Solomon Grundy oder Peter Greenaways Debütfilm „A Zed And Two Naughts“ – recht eigentlich ist das aber herzlich egal, weil Zavalas Lyrics nach wie vor einen rein dekorativen Charakter haben. Gesungen wird, was gut klingt, und wenn es nur Textzeilen sind wie „I’m a landmine / I’m a landmine / So don’t you step on me …“ Das klingt nicht nur wie eine Warnung, es ist auch eine. Wer sich auf diese Musik einlässt, den lässt sie nicht mehr los. Key Tracks: „The Whip Hand“, „In Absentia“