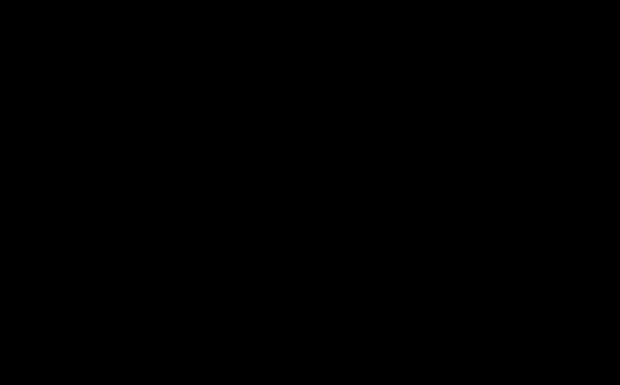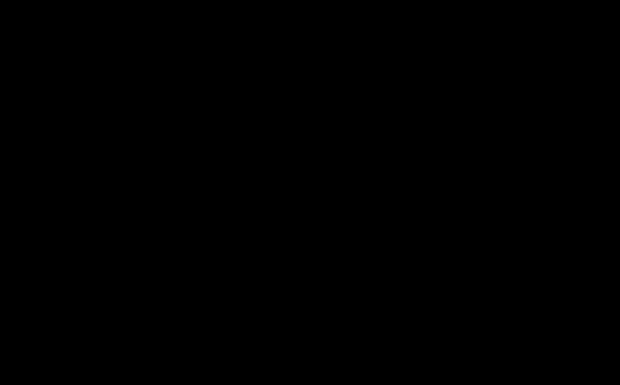Konzertbericht: So war es bei The Strypes im Berliner Postbahnhof
The Strypes spielten am 14.04.2014 im Berliner Postbahnhof und zeigten dabei etwas zu viel Attitüde.
Coolness als Image – diese Attitüde leben The Strypes aus Irland voll aus, als sie am 14. April 2014 im Berliner Postbahnhof auftreten. Gerade mal um die 17 Jahre alt, setzen die vier irischen Jungs mit Anzugklamotten, Hemd und Krawatte viel auf ihr äußeres Erscheinungsbild, verkörpert Sänger Ross Farrelly mit seiner schwarzen Sonnenbrille und der distanziert-arroganten Pose die Stereotype des klassischen Rockstars.
Die Referenzen an ihre Vorbilder ragen dabei immer überdeutlich heraus. Äußerlich wirken sie wie „The-Beatles-Stil trifft auf Oasis-Attitüde“, musikalisch setzen sie auf Rock And Roll á la Chuck Berry oder Yardbirds – leider nur (noch) nicht mit so viel Groove und Ideenreichtum. Alle Songs werden in relativ ähnlichen Taktfolgen gespielt, die Melodien wirken austauschbar, ein paar kurze Gitarrenriff-Soli sollen für etwas Abwechslung sorgen.
Was man den vier jungen Musikern, die 2013 ihr Debütalbum SNAPSHOT – übrigens produziert von Chris Thomas, der bereits mit The Beatles und Sex Pistols arbeitete – dagegen nicht vorwerfen kann, das ist die Power und Energie, die sie auf die Bühne werfen, schonungslos den Sound nach vorne preschend. Songs wie „What A Shame“ oder „Hometown Girls“ werden mit Tempo gespielt, langsame Nummern zum Verschnaufen sind schlicht Mangelware.
Rock And Roll – den Spirit, den sie verkörpern wollen – ist hier an jeder Stelle spürbar, doch bei The Strypes wirkt der unbedingte Wille so sein zu wollen wie ihre eigenen Helden an manchen Stellen gekünstelt. Und das nicht nur wegen dem bereits oben schon beschriebenen etwas albernen Theaters, das der Sänger mit seiner dunklen Sonnenrille nicht nur auf diesem, sondern wohl jedem Konzert abzieht. Auch der mit zusammengekniffenen Augen angestrengte Blick des Gitarristen und Co-Sängers Josh McClorey, als ob er sich damit an den Zuschauer heranpirschen wolle, wirkt auf die Dauer wie einstudiert.
Sprichwörter sind meist zwar nur Floskeln, doch der Satz „Manchmal ist weniger mehr“ könnte hier nicht besser passen. Weniger wie ihrer Vorbilder sein und handeln, mehr ihre eigenen Vorstellungen von Musik und Auftreten zeigen, all das würde der Band gut tun. Noch sind sie jung, vielleicht bieten sie uns das ja dann auf ihrem zweiten Werk und ihrem nächsten Besuch in der Hauptstadt.