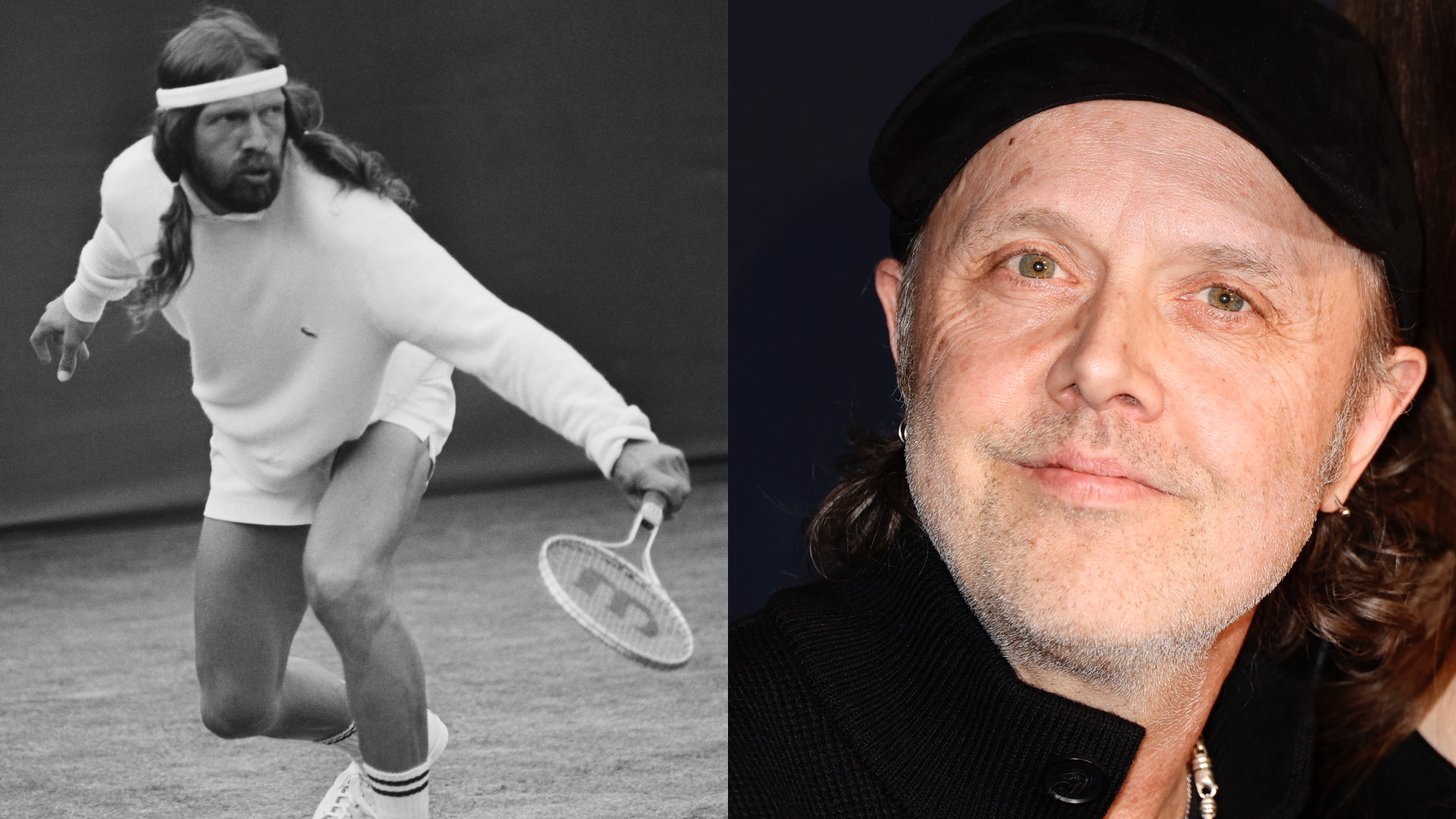Paradise Lost: Metal à la Mode
Die Metaller von PARADISE LOST haben einen Sinneswandel hinter sich: Ihr neues Album "Host" wendet sich an Freunde düsterer Popmusik im Stil von Depeche Mode.
Der britische Romantiker und Schriftsteller John Milton beschreibt in seinem monumentalen Gedicht „Paradise Lost“, wie Luzifer aus dem Himmel vertrieben wird und sich an Gott rächt, indem er dessen Geschöpfe Adam und Eva zur Sünde verführt. Das Werk endet mit dem Versprechen, die sündige Menschheit werde durch die Wiederkehr Christi dereinst erlöst. Zugegeben, die 1988 in Halifax in der englischen Grafschaft Yorkshire gegründeten Paradise Lost hatten sich ihren Namen keineswegs der literarischen Vorlage entlehnt – er klang einfach nur ausreichend verzweifelt und düster. Dennoch läßt sich der Werdegang der Band annähernd analog zu dieser biblischen Handlung lesen.
Begonnen hat es mit aggressivem, brutalem Death Metal, von dem Sänger Nick Holmes einmal sagte, er sei froh, daß sie damals keine satanischen Texte hatten, denn so könne man wenigstens halbwegs stolz auf die Anfänge zurückblicken. In ihrer zweiten Phase, mit Alben wie „Shades Of God“ (’92), „Icon“ (’93) und „Draconian Times“ (’95), perfektionierten Paradise Lost die neuartige Mischung aus traditionellem Heavy Metal und Gothic zu einem typisch schwermütigen Klang, die ihnen in Metalkreisen zu außerordentlicher Popularität und einem gewissen Kultstatus verhalf.
Auf dem ’97er Album „One Second“ flössen erstmals elektronische Elemente in die Heavy Metal-Songstrukturen ein. „Damals haben wir das als Experiment angesehen“, erklärt Hauptsongwriter Greg Mackintosh, „aber es hat sich herausgestellt, daß wir zu halbherzig vorgegangen sind. ‚One Second‘ war weder Fisch noch Fleisch, eigentlich haben wir nur einige der jetzt auf’Host‘ dominierenden Ideen auf normale Metalsongs aufgesetzt. Die Devise für ‚Host‘ konnte nur lauten: Alles oder nichts.“
„One Second“ war gleichzeitig das letzte Album vor Paradise Losts Wechsel zum Major EMI, „was man“, so Nick, „leider deutlich gemerkt hat. Denn sobald klar wurde, daß wir unseren alten Vertrag nicht verlängern wollten, hat unsere damalige Firma jede Unterstützung eingestellt. ‚One Second‘ hing somit etwas in der Luft.“ Und das nicht nur in geschäftlicher Hinsicht. Der sich andeutende Stilwechsel irritierte viele der alten Metalfans, denen es nach Neuauflagen von klassischen Paradise Lost-Hymnen wie „As I Die“ oder „The Last Time“ gelüstete.
Für Greg allerdings haben derb verzerrte Moll-Riffs und altbekannte Metal-Strickmuster ihren eigentümlichen Reiz schon lange verloren: „Zu jedem Refrain massive Gitarren! Alles lief nach einer einzigen Formel ab, so daß ich beim Songwriting kaum mehr nachdenken mußte. Die Methode war so abgelutscht, daß sie mir schon in Fleisch und Blut übergegangen war. Um aus dieser kreativitätstötenden Routine auszubrechen, mußte ich alles in Frage stellen: Von den Sounds über die Rolle der einzelnen Instrumente bis hin zur Kompatibilität mit einem bestimmten Genre, in dem wir bis dahin nunmal zu Hause waren.“
Rückblickend wirken die bisher erfolgreichsten Jahre der Band – Mitte der Neunziger mit „lcon“ und „Draconian Firnes“ – wie eine Zeit des Konfliktes zwischen bewährten Erfolgsrezepten auf der einen und künstlerischen Ambitionen auf der anderen Seite. Schon damals machte Greg wenig Mehl aus seiner Vorliebe für Bands wie Depeche Mode oder The Cure. „Ich habe mich fast wie ein Schizophrener gefühlt“, erklärt er heute. „Der Musiker und der Musikfan in mir waren zwei verschiedene Personen.“ Gewohnheit und der Druck der übrigen, eher dem Heavy Metal zugeneigten Musiker, verhinderten einen früheren Stilwechsel. Mittlerweile hat Greg jedoch die gesamte Verantwortung für die Musik an sich gerissen und seine Vorstellungen durchgesetzt. Dabei gewöhnte er sich auch eine ganz neue Arbeitsweise an: Wurden früher die Songs im Proberaum mit den übrigen Bandmitgliedern Aaron Aedy (Gitarre), Steve Edmondson (Bass) und Lee Morris (Schlagzeug) erarbeitet, so entsteht heute die gesamte Musik am Computer in Gregs Homestudio. „Früher habe ich ausschließlich Gitarrenriffs geschrieben“, erinnert er sich. „Heute dagegen liegt der Schwerpunkt bei den Arrangements. Ich beginne meist mit einem Rhythmus und einigen Soundideen, arbeite das in meinem Studio aus und gebe schließlich ein Band an Nick weiter, dessen Gesang mittlerweile der hauptsächliche Melodieträger bei uns geworden ist.“
Trotzdem sind sich Greg und Nick einig, daß sie die Band weiterhin brauchen – nicht nur als Statisten für Liveauftritte. „Man kann fast alle Sounds rein elektronisch erzeugen“, so Greg, „aber letztlich benutze ich vor allem Samples von dem, was Aaron, Steve und Lee spielen. Es geht nicht nur darum, daß wir weiterhin eine vollwenige Liveband bleiben und nicht neunzig Prozent der Musik vom Band spielen wollen. Ich möchte auch die Lebendigkeit ‚richtiger‘ Instaimente nicht missen.“
„Host“ ist ein Album, an dem die klassischen Paradise Lost-Fans schwer zu schlucken haben werden – die Nähe zu Depeche Mode und zur Popmusik ganz allgemein ist zu offensichtlich. Greg und Nick sehen aber gerade darin eine enorme Chance nicht nur für Paradise Lost, sondern für das ganze siechende Genre: „Wir brauchten einen radikalen Schnitt“, erläutert Nick. „Ansonsten blieben wir in den Augen der Musikwelt immer eine Metalband.“ Ganz klar geht es den Briten daaim, sich neue Zuhörerkreise zu erschließen. Nur inhaltlich ist alles beim alten geblieben. Paradise Lost, die Band, die Depressionen und dem Unglücklichsein eine neue musikalische Stimme verliehen hat, bleiben sich in dieser Beziehung treu.
„Ich singe viel über den Tod“, erklärt Nick, dessen Vater im Sommer des letzten Jahres gestorben ist. „Aber es ist kein Album über den Tod, eher über die Erfahrung des Lebens im Angesicht des Todes.“ Die Stimmung, die Paradise Lost vermitteln, ist wie das Erleben einer schweren Depression – aber unter Einfluß des chemischen Gemütsaufhellers Prozac. „Das trifft den Kern“, schmunzelt Nick und bekennt, daß er selbst seit längerer Zeit Antidepressiva nimmt. „Diese Medikamente machen einen nicht glücklich, aber sie nehmen den konkreten Dingen, die einen ansonsten runterholen, die Bedeutung.“
Eine Wirkung, die sich auch auf seine neue Lyrik erstreckt: „Auf ‚One Second‘ habe ich bewußt versucht, Texte mit einer Geschichte und einem interpretierbaren Sinn zu schreiben – weil ich unbedingt die großen, ewigen Fragen beantworten wollte, die uns alle beschäftigen. Wie sich aber herausstellte, war das hohl, unehrlich und anstrengend. Auf ‚Host‘ beruhen alle Worte auf Gedanken und Einfällen, die auf den Zuhörer vielleicht diffus wirken, in denen ich mich aber wiederfinden kann.“
Genauso abwehrend, wie Nick sich am liebsten um allzu tiefgehendes Gründeln in seiner Künstlerseele drücken möchte, reagieren Paradise Lost auch auf die sicher nicht ganz von der Hand zu weisende Kritik, sie hätten nach Jahren, in denen sie innerhalb der Metalszene Trends gesetzt haben, nun ein Album aufgenommen, daß wenn auch handwerklich gut gemacht – bestehende Musik einfach aufgreift, kurz: abkupfert, genauer: Depeche Mode abkupfert. Für Greg ist das alles eine Frage der künstlerischen Integrität: „Wer sagt, daß alle noch so verschlungenen und originell anmutenden Pfade immer zu einem unbekannten Ziel führen müssen? Für mich ist ‚Host‘ eine überaus logische Konsequenz aus allem, was wir bisher gemacht haben. Musikalisch wie inhaltlich kann ich keine dramatischen Unterschiede zu ‚One Second‘ feststellen, der Charakter ist derselbe geblieben. Einzig die Arrangements und der Sound haben sich verändert. Das wird bestimmt einige Leute abschrecken, aber ich kann den Vorwurf nicht gelten lassen, wir hätten unsere künstlerische Integrität kommerziellen Überlegungen geopfert.“
Was auf Platte vielleicht nicht wirklich geglückt ist, schaffen Paradise Lost auf der Bühne mit Leichtigkeit. Schon während einer Geheimtoumee, bei der eigentlich nur getestet werden sollte, wie sich Computersequenzen auf eine organische Band übertragen lassen, wurde deutlich, daß die Grenzen zwischen Härte und Pop durchaus verschwimmen können: Die Gitarrensounds, die bei der finalen Abmischung der Platte etwas zahm und verhalten weggekommen sind, erhoben live ihr schneidiges Haupt – und schlugen eine majestätische Brücke zwischen Depeche Mode und Metallica.