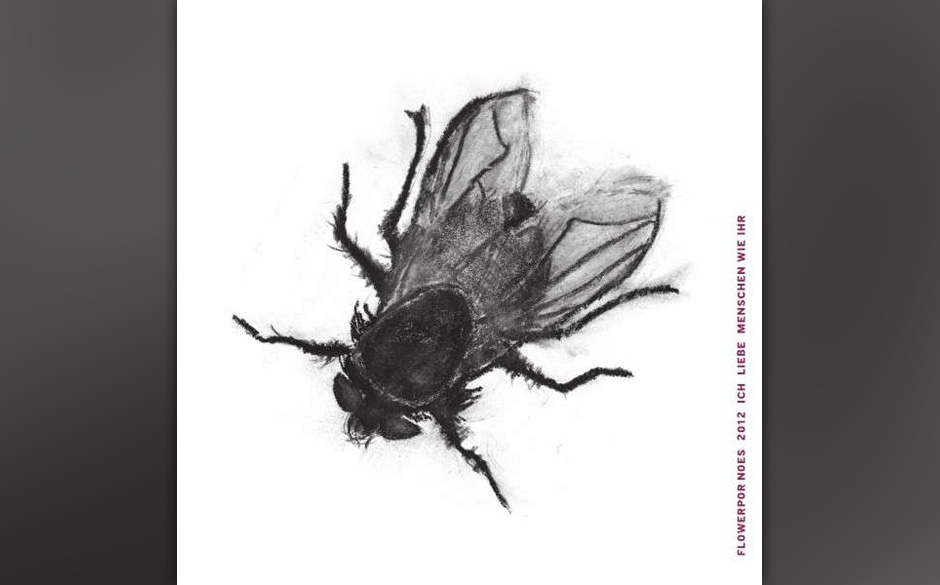Simple Minds: Jim Kerr im Interview
Drei Jahre und sechs Monate mußten ins Land gehen, bevor die Simple Minds die Angst ihrer Fans um die Existenz der schottischen Kultband mit der EP "Ballad Of The Streets" vom Tisch wischten. Ein neues Studio-Album folgt Ende April, eine Deutschland-Tour im Juni. Für ME/Sounds brach Mastermind Jim Kerr endlich sein Schweigen und sprach mit Hanspeter Künzler erstmals über die Selbstzweifel der Simple Minds, seine Liebe zu Schottland und das Scheitern seiner Ehe mit der Pretenders-Chefin und Sängerin Chrissie Hynde.
ME/SOUNDS: Geschlagene 31/2 Jahre sind seit „Once Upon A time“ verstrichen. Warum hat es so lange gedauert, bis ihr nun mit der EP „Ballad Of The Streets“ wieder neue Songs veröffentlicht habt?
KERR: „3 1/2 Jahre ist in der Tat eine lange Zeit. Wir wußten, daß wir ein Risiko eingingen, eine lange Pause einzulegen, daß wir damit vielleicht sogar eine Art Band-Selbstmord begingen. Aber es mußte einfach sein. Es war höchste Zeit, daß wir uns hinsetzten und uns in Frage stellten.“
ME/SOUNDS: Euer letztes Album wurde von Jimmy Iovine und Bob Clearmountain produziert und deutete an, daß euer Zielfernrohr auf die US-Stadien eingestellt war. In dieses Bild paßt nun „Ballad. ..“ weder von der Stimmung noch von der Aussage her.
KERR: „Was geschah war folgendes: Bevor wir uns mit damals Iovine zusammentaten, merkten wir schon, daß alles um uns herum brodelte, daß wir an der Pforte zur Topliga angekommen waren. Das war beängstigend, zumal unsere Ursprünge ja in der Punkgeneration lagen. Wir lebten nur für die Musik und hatten Spaß daran. Es wurde aber langsam klar, daß wir unsere Zeit nicht richtig nutzten, wir ließen einfach zuviel mit uns geschehen. Plötzlich kam ein gewisser Rebellengeist mit ins Spiel: Ließen wir, Arbeiterjungs aus Glasgow, uns etwas von anderen, Typen wie Joe Strammer, sagen, was wir zu tun hatten… Wer sagte denn, daß diese Anti-Haltung der Punks die einzig richtige war? Wir beschlossen also, am eigenen Leib zu erfahren, was Sache war. Tatsächlich gelang uns der Sprung in die Liga der Großen, was uns dann allerdings ebenfalls klar wurde, war, daß wir in dieser Art von Big Business sehr viel an Flexibilität einbüßen.“
ME/SOUNDS: Ist es dann nicht komplett zu spät, um noch zu reagieren?
70er Jahre, deren Absturz auf musikalischer wie gesundheitlicher Ebene sehr rapid war. Ich will diese Bands nicht kritisieren, wir versuchten aber, aus ihrem Beispiel zu lernen, wie man in der Achterbahn des Rockbusiness überleben kann, ohne die Außenwelt aus den Augen zu verlieren.“
ME/SOUNDS: Meiner Meinung nach klang schon „Once Upon A Time“ so, als würde hier nochmal gründlich „Sparkel In The Rain“ abgegrast.
KERR: „So wie wir das Album aufnahmen, was wir hineinlegten, da fehlte es an unserer früheren Einfallskraft. Aber es gehört zum Leben einer Band, die es seit acht, zehn Jahren gibt, daß sie mal bessere, mal schlechtere Zeiten hat. Das Problem ist, sich nicht einzureden, die letzte Platte sei phantastisch, wenn sie in Wirklichkeit eher mäßig war. Aber es gibt genug Beispiele, daß es wieder aufwärts gehen kann. Schau dir nur all die großen Künstler an, die nach Jahren der Flaute plötzlich wieder mit großartigen Alben hervortreten. Van Morrison z. B., oder Lou Reed.“
ME/SOUNDS: Für „Sparkel In The Rain“ habt ihr eine Version von Lou Reed’s „Street Hassle“ eingespielt. Auf eurem neuen Album singt er einige Backing Vocals. Was fasziniert äch an ihm?
KERR: „Abgesehen davon, daß er ein phantastischer Songwriter ist, ist er auch ein aufgeschlossener Beobachter. Seine neue LP beweist das wieder. Kommt dazu, daß du sofort hörst, wie jeder – du, ich – Songs wie „Sweet Jane“ oder „White Light – White Heat“ spielen könnten, ein paar Stunden, nachdem wir erstmals eine Gitarre in die Finger genommen haben. Das hat mir damals, als ich 18 war, unheimlich Mut gemacht.“
ME/SOUNDS: Wen würdest du sonst noch unter die ganz Großen einreihen?
KERR: „Van Morrison zum Beispiel, obwohl er für ganz andere Werte steht, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Peter Gabriel hat eine großartige Kraft, hat nie seine Würde verloren. Springsteen – obwohl mir das Kleinstadt-Amerika seiner Texte fremd bleibt. Und Dylan – „Blood On The Tracks“ ist für mich geradezu shakespearisch.“
ME/SOUNDS: Mir scheint, bislang haben die Simple Minds mit ihrem Publikum auf einer klanglichen Ebene kommuniziert – mit üppigen, brausenden Refrains. Auf dieser LP sind nun die Texte, die du singst, in den Vordergrund gerückt und es wird darin auch etwas ganz Konkretes ausgesagt.
KERR: „Richtig Ja! Und ich bin froh, daß es so gekommen ist. Es scheint mir, früher hätte meinen Texten ein geradezu voyeuristischer Zug angehaftet. Ich betrachtete alles von einer abgehobenen Warte aus, ohne mich jemals wirklich irgendwo zu beteiligen. Heute sind meine Texte sehr viel militanter geworden. Sie stehen nun im Zentrum unserer Musik, nicht mehr umgekehrt.“
ME/SOUNDS: Kannst Du diese Entwicklung etwas genauer erklären?
KERR: „Nun – ich bin älter geworden. Und mit dem Älterwerden ist in mir die Überzeugung gewachsen, daß Songwriter versuchen sollten, Zeugnis über die wichtigsten Lebensabschnitte abzulegen. Als ich 18, 20 war, schien mir die Überzeugung ganz natürlich, die Welt sei ohnehin beschissen, da könne man nichts machen, außer irgendwie die Flucht zu ergreifen. Wenn die Regierung ein Gesetz beschloß, das mir willkürlich schien, dachte ich einfach: Klar, die Typen sind alle korrupt und deren Welt hat mit meiner Welt nichts zu tun. Wenn die Regierung jetzt etwas durchdrücken will, was mir amoralisch vorkommt, überlege ich mir inzwischen: Wie kann ich dagegen protestieren? Trotzdem lebe ich gern in der heutigen Zeit, bin ich gern so alt, wie ich nun bin. Ich sehe eine neue Generation von Menschen heranwachsen, der gegenüber ich ein echtes Verantwortungsbewußtsein spüre. Ich will am Geschehen teilhaben, anstatt den Rücken zu kehren. Das hat sich natürlich auf unser neues Album ausgewirkt. Fast jeder Song handelt von einer Art Konflikt. Sei dies in einem konkreten Sinn – Belfast, Mandela, soziale Gerechtigkeit – oder auch in einem persönlichen Sinn: Die Konflikte, die mich ganz direkt betreffen.“
ME/SOUNDS: Das Reisen hat früher in deinen Texten eine wichtige Rolle gespielt. Doch inzwischen scheinst du in mehrfacher Hinsicht nach Hause zurückgekehrt zu sein. Du wohnst nahe Edinburgh, die Band hat ihr Studio hier am Loch Earn.
KERR: „Ich hatte Glasgow noch nie verlassen, bevor ich als 16jähriger mit Charlie Burchill per Anhalter durch Europa fuhr. Danach ging alles blitzschnell. Wir waren plötzlich in einer Band, die jahrelang pausenlos herumreiste. Erst als wir nun diese Pause eingelegt hatten, wurde uns bewußt, wie sehr wir mit Schottland, oder vielmehr mit Glasgow, verwachsen sind. Ich wuchs im 14. Stock einer Sozialbausiedlung in einem Arbeiterviertel auf. Ich habe sehr schöne Erinnerungen an jene Zeit. Es herrschte ein phantastisches Zusammengehörigkeitsgefühl und eine ganz spezielle Art von Humor dem schwierigen Alltag gegenüber. Vor diesem Hintergrund ist heute meine „sozialistische“ Haltung zu sehen. Der Zerfall solcher Werte ist erst später gekommen, als die Industrie hier oben ruiniert wurde und die Jobs massenweise verloren gingen. Auch die Schönheit der schottischen Natur wirkt sich auf mein Wohlbefinden aus. Hier oben kann ich mich auf echte Weise konzentrieren. Als ich Chrissie heiratete, versuchte ich eine Weile lang in London zu leben. So sehr ich es schätzte, von Kinos, Museen und Theatern umgeben zu sein, war es letztlich nichts für mich. Die ganze Zeit in London habe ich keine einzige Zeile schreiben können.“
ME/SOUNDS: Kannst du die Hintergründe der Single „Belfast Child“ beschreiben? Es handelt sich dabei ja um eure Version eines alten Volksliedes.
KERR: „Ich bin oft in Irland. Meine Großeltern auf beiden Seiten stammen aus Irland und ich habe Freunde da, weiß, wie der Alltag aussieht. Es erstaunt und befremdet mich immer wieder, wie man in England die Probleme Nordirlands ignoriert. Die Bombe von Enniskillen hat mich zutiefst berührt – es war einfach schrecklich. Das hat mir wieder vor Augen geführt, wie furchtbar die Situation dort ist, und wie negativ die Vision auch der IRA. Ich versuchte mir ein Leben vorzustellen, das tagaus, tagein mit solchen Spannungen umgehen muß. Ein Kind, das an jenem Abend in Belfast geboren wurde – wie sah seine Zukunft aus? Im zweiten Teil des Songs wird ein persönliches Erlebnis reflektiert, das wohl auch in mehreren anderen Songs auf dem Album durchschimmert: Im vorletzten Jahr ging ein Freund von mir auf eine Party in Glasgow. Als eine Schlägerei ausbrach, verließ er den Raum. Draußen waren einige andere Kids, die waren high vom Leimschnüffeln und haben ihn erstochen. Ich verbrachte die nächsten 2, 3 Tage mit seinem Bruder. Es war seltsam: Keiner von uns hatte irgendwelche Rachegefühle. Vielmehr war da ein drückendes Gefühl der Leere, der Sinnlosigkeit, vom traurigen Wahnsinn im Chaos heutiger Städte. Das konnte ebenso Belfast sein wie Beirut oder Johannesburg. Der Text ist mein Versuch, einem ganzen Labyrinth von Gefühlen Ausdruck zu geben und dabei auch Hoffnung zu sehen.“
ME/SOUNDS: Haben solche Erlebnisse gleichzeitig Eure Musik in eine andere Richtung gelenkt?
KERR: „Die Musik dazu entstand anders: Wir alle waren einfach gelangweilt von der gegenwärtigen Rockmusik und haben begonnen, uns anderswo umzuschauen. Charlie hat sehr viel Blues gehört, Michael McNeil, ist mit einem Akkordeon aufgewachsen – er hätte sich gern mal wieder mit den traditionellen Strukturen von Volksmusik befaßt. Wir fragten uns als Band, ob Rockmusik wirklich das einzige war, das wir spielen konnten. Ob wir nicht auch einen Folksong glaubwürdig interpretieren könnten. Ich hörte einen Bassisten
eines Tages eine einfache Melodie spielen, die mich absolut fesselte. Es stellte sich heraus, daß es ein alter Song war, „She Moved Through The Fair“. Er wirkte spontan inspirierend auf mich – die Worte für den Text sprudelten geradezu aus mir heraus,“
ME/SOUNDS: Auch „Mandela Day“ ist mit seinem leichtfüßigen Rhythmus mit keinem früheren Simple Minds-Stück vergleichbar.
KERR: „Als Jerry Dammers uns fragte, ob wir beim Mandela-Konzert auftreten wollten, war die Rede von drei, vier Bands mit einigen Gästen, die zudem alle einen Song eigens für dieses Konzert schreiben würden. Das schien mir eine großartige Idee – wir taten uns dann aber sehr schwer damit. Wir waren schon ziemlich verzweifelt. Da programmierte Mick eines Tages ein Drum-Muster in den Computer. Es klang wie „Ruby Don’t Take Your Love To Town“. Wir lachten uns zuerst krumm – da fing Charlie plötzlich an, lockere Kaskaden drüberzuspielen. Unser Bassist war mal kurz zum Pissen gegangen, als er zurückkam, war „Mandela Day“ fertig.“
ME/SOUNDS: Wie hast du das Mandela-Konzert rückblickend in Erinnerung?
KERR: „Als plötzlich immer mehr Bands aufs Programm kamen, wurde ich skeptisch. Es war dann auch frustierend, wie die politische Dimension unter den Teppich gekehrt wurde und einige Künstler nur da waren, weil das förderlich für die Karriere war. Typen wie George Michael – selbst im Interview ist er politischen Fragen ausgewichen. Der wußte ja genau, daß er in spätestens einem halben Jahr einen Pepsi-Jingle machen würde, da wollte er nicht ins Fettnäpfchen treten. Schade ist auch, daß niemand sonst einen Song für das Ereignis geschrieben hat. Eine ganze LP voller Mandela-Songs, das wär was gewesen!“
ME/SOUNDS: Worum geht es im Titelsong der neuen LP „Street Fighting Years“?
KERR:“Meine Hauptangst für die kommenden Jahre ist, daß Frau Thatcher den Zusammenbruch von sozialem Zusammengehörigkeitsgefühl weitertreibt. Sie fördern ausschließlich Yuppies – da denke ich nicht an CD-Player und Sportwagen, sondern an Menschen, die nur an sich selber denken. Die Straße andererseits ist für mich ein Ort, wo Menschen zusammenkommen. Ich hoffe sehr, daß es in England demnächst einen schönen Sommer gibt, die Leute wieder mehr Zeit auf der Straße verbringen und daraus vielleicht eine neue Art von Militanz erwächst.“
ME/SOUNDS: Eure Musik klingt heute bedeutend weniger elektronisch als früher. Doch ausgerechnet jetzt holt ihr den Computer-Guru Trevor Horn dazu?!
KERR: „Wir hatten schon lange gehört, daß Trevor unsere Musik mochte. Wir mochten an seiner Arbeit vor allem die Dynamik. Doch mißtrauten wir ihm auch. Wir mochten diese Aura des Künstlichen überhaupt nicht. Das war uns alles zu viel Spielberg. Wir dachten ursprünglich an Stephen Lipsom als Produzent. Er hatte mit Propaganda „Secret Wish“ aufgenommen und da waren zwei Tracks drauf, die wie Songs aus unseren frühen Tagen klangen. Wir arrangierten also ein Meeting mit Stephen. Der wird vom gleichen Manager betreut wie Trevor Horn, der sich dann auch ganz ungeniert ins Meeting geschwätzt hat. So sagten wir uns halt: Vergessen wir mal unsere Vorurteile und heuerten Stephen und Trevor als Ko-Produzenten an. Es stellte sich heraus, daß unsere Befürchtungen mit Trevor nicht unbegründet waren. Doch war er ebenso wie wir gewillt zu lernen. Ihm ging es darum, endlich mal mit einer richtigen Band zu arbeiten. Ohne Stephen aber wäre nichts zustande gekommen.“
ME/SOUNDS: Was hat Trevor Horn dann zu eurer Musik beigetragen?
KERR: „Er hat eine ungeheure Phantasie. Ständig sprudeln Ideen aus ihm heraus. Bei den ersten 14 steht dir ganz danach, ihn auf Nimmerwiedersehen aus dem Studio zu feuern. Dann kommt er mit Idee 15, die dir glatt den Atem nimmt.“
ME/SOUNDS: Ist Drummer Mel Gaynor noch Mitglied der Band?
KERR: „Ich hoffe, daß er nicht länger die beleidigte Leberwurst spielt. Das tut er nämlich schon verdammt lang. Er wurde sauer, weil… nun, live ist er der beste Drummer der Welt. Doch als es um dieses Album ging … Ich hatte diesen krachenden, monumentalen Drum-Sound, der nun seit hundert Jahren ein Stilmerkmal der Simple Minds ist, total über. Nur fand es Mel dann etwas schwierig, mit der sensibleren Natur einiger neuer Songs umzugehen. Wir möchten ganz gern eine Band sein, doch im Grunde waren Charlie, Mick und ich immer der Kern der Gruppe. In diesem Moment bestehen die Simple Minds aus uns dreien.“
ME/SOUNDS: Deine Ehe mit Pretenders-Sängerin Chrissie Hynde ist inzwischen zerbrochen, was ja auch von der britischen Boulevardpresse breit ausgewalzt wurde. Es war sicher schrecklich, seine persönlichen Probleme in der Zeitung zu lesen?
KERR: „Haha! … Ja. das ist es. Um ehrlich zu sein: Solche Zeitungen lese ich selber nie, doch wird dir natürlich zugetragen, was da geschrieben wird … Es ist nun über ein 1 Jahr her, daß wir uns trennten, aber ich kann erst jetzt darüber reden. Unser Problem war, daß wir beide in diesem Business arbeiten, in dem man ständig stark unter Druck steht. Es ist ungemein schwierig, Zeit für ein Familienleben zu finden – zumal wir ja beide unsere eigene Band haben. Ausschlaggebend war letztendlich, daß ich unmöglich in London leben kann und Chrissie auf gar keinen Fall in Schottland. Auf einen Kompromiß konnten wir uns nicht einigen. Zum Glück waren wir beide fähig mit der Trennung einigermaßen intelligent umzugehen. Ich bin ja nach wie vor Vater, habe Vaterpflichten nachzukommen. Wir sind immer noch eine Familie. Ich gehe so oft wie möglich nach London, um unsere Tochter zu besuchen. Und ich muß sagen – Chrissie ist wirklich die Größte. Auch eine phantastische Mutter. Klar ist’s Scheiße, daß es so gekommen ist, doch wie sagt man so schön: Nimm das Leben, wie es kommt!“