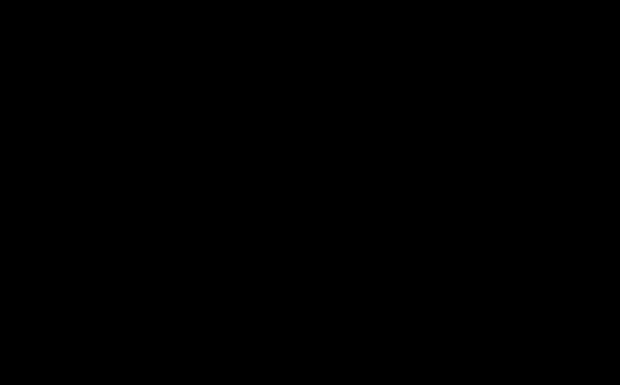J Dilla
The Diary
Pay Jay/Mass Appeal
Sein Lebensalbum als Rapper nahm der legendäre HipHop-Produzent vor mehr als 15 Jahren auf, mit Beats von u. a. Pete Rock, Bink und Madlib. Nun erscheint es endlich.
Drei Tage nach seinem 32. Geburtstag starb James Dewitt „J Dilla“ Yancey am 10. Februar 2006 an der seltenen Blutkrankheit TTP. Im Februar jährte sich sein Tod also zum zehnten Mal. In diesen zehn Jahren ist die Verehrung des Beatproduzenten aus Detroit zu einem Kult angewachsen und schließlich zum Klischee verkommen. Das hätte Dilla nicht gewollt. Was er hingegen wollte, ist dieses Album: Einmal ein ganz normaler Rapper sein, kein Betriebsheiliger, sondern einfach ein Dude aus dem D, der sich die dopesten Beats einkauft, um darüber irgendwelchen Quatsch über Weiber, Karren und teuren Fusel zu erzählen. Der Wunsch blieb ihm zu Lebzeiten verwehrt. Dafür hat sein Nachlassverwalter Eothen „Egon“ Alapatt nun sogar Dillas Markennamen „Pay Jay“ reanimiert, um dieses Herzensprojekt dem posthumen Zelebrationszirkus zuzuführen.
In diesem Kontext ist THE DIARY tatsächlich eine Großtat. Außerhalb dessen aber ist es schwer zu bewerten – und manchmal schwer zu ertragen. Wenn etwa Dillas langjährige Kumpels und Lieblingsrapper Frank-N-Dank auf „The Anthem“ den Fetenhit „Fiesta“ von R. Kelly anstimmen, ist das höchstens unter archivarischen Gesichtspunkten amüsant. Auch Stücke wie „The Creep“ und „The Shining“ waren einst fintenreiche, beeindruckend böse und gleichzeitig befreiende Club-Banger eines missverstandenen Genies – heute wirkt selbst die Kategorienbezeichnung altbacken, die Musik zwischen den üblichen Retrozirkeln seltsam verloren.
Der Vergleich mit Rapmusik 2016 ist unfair; diese Musik war für das Hier und Jetzt von damals gedacht. Aber wenn man sich THE DIARY nicht nur als Artefakt in den Schrein stellen, sondern tatsächlich auch pumpen möchte, ist er eben unvermeidbar. Am besten klingt diese 2000er Platte im Frühjahr 2016, wenn Dilla sich vom Zeitgeist frei- und sein eigenes Ding macht. Auf „Trucks“ etwa baut er ein kühles New-Wave-Sample zur Clubhymne um; der Klassiker „Fuck The Police“ ist ein Anti-Bullen-Asi-Song über obskure Library-Sounds. Wer hat solche Kombos? Niemand, und das ist nicht nur eine Watschn für den Dilla-Revisionismus selbst berufener Kulturbewahrer, sondern auch Zeugnis seiner einzigartigen musikalischen Gabe.