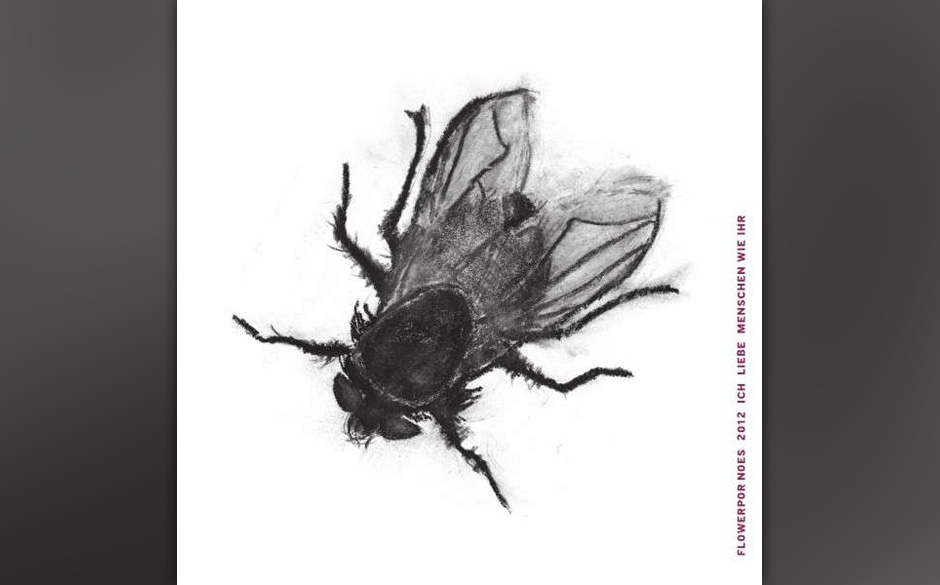Simple Minds: Hamburg, Alsterdorfer Sporthalle
Es war schlicht (und für viele sogar ergreifend) die Wiedergeburt des Rockkonzerts, wie man es sich bis Mitte der 70er Jahre als „großes Erlebnis“ reinziehen konnte. Alle Deutschland-Auftritte der Simple Minds fanden dementsprechend in Hallen statt, in die euphorisch gestimmte Massen (in Hamburg satte 6500!) die Wärme schon selbst mitbringen mußten. Weitere unersetzliche Zutaten: spektakuläre Bühnenaufbauten (statt der Verstärkerburgen aus den Sixties allerdings Podeste als Auslauf und Sprungbretter); psychedelisch angehauchte Lichteffekte (die Helden am Pult müssen die Songs im Schlaf pfeifen können, um die computergestützte Strahler-Choreographie so im Griff zu haben, daß sie penibel jeder Phrase und jedem Break folgt); last not least – ein Sänger mit Charisma.
Und das hat der schmächtige „Simplizissimus“ Jim Kerr – auch wenn seine beschwörenden Missionarsgebärden dem nüchternen Beobachter aufgesetzt erscheinen. Aber wer in der wogenden Menge ist schon nüchtern? Wo immer Jim (der ansonsten von links nach quer springt, daß der Fotografenfinger am Entfernungsring wund wird), zum Shakehands in die Knie geht, wachsen ihm gierige Arme entgegen, als hätte er Wunderheilungen im Repertoire.
Shitwölkchen, keyboardgetragene Walls of Sound, ruhig dahinstampfende Rhythmen – Verzückung statt Alltagsärger. Bei allem Hymnenbombast sollte man die Simple Minds nicht vorschnell in einen Topf werfen mit den „boring old farts“, gegen die sie einst mit angerauhten Waveklängen antraten. Die Mega-Rockstars von heute geben sich religiös statt dekadent, spielen für Nelson Mandela statt für Heroin. Zum Dank wedeln die Fans in vorderster Front mit Fähnchen (Aufschrift allerdings U2!) und idealistischen Transparenten („Don’t dream it – be it“). Den Schotten gefällt’s.
Fühlt sich auch wirklich jeder im Saal ganz persönlich angesprochen? „Let me see your hands!“ Die Dramaturgie soll keinen auslassen. Jeder Song mündet in eine pathetische Steigerung. Wenn’s mal sanft bleibt, hört man nervös-militante Mitklatscher – auch wo es gar keinen Rhythmus zum Einsteigen gibt. Vor mir verteilt eine Mutter die Wunderkerzen an ihre Minderjährigen. Und schon wieder eilen die Freizeit-Rhythmiker im Saal dem getragenen Midtempo-Beat gnadenlos voraus.
Eine Stunde ist rum, und das Geschehen kreist längst um sich selbst. Auch die auf- und absteigenden Jalousien, die ständig wechselnden Projektionen auf haushohe Leinwandbahnen können keine wirkliche Bewegung suggerieren.
Aber dann tritt der „additional lead singer“ (laut LP-Cover) Robin Clark auf: eine stimmgewaltige Schwarze, die das musikalische Spektrum gewaltig in Richtung Soul erweitert.
Lou Reeds „Street Hassle“ versumpft nach überraschend trockenem Start doch noch im Klangmeer. Bei „Alive And Kicking“ deutet der Knabe vor mir seinem Papa, daß nun endgültig keiner mehr auf dem Sitz kleben bleiben darf.
Die laute(re) Erweckungsveranstaltung endet rundum erfolgreich: Der Seelenkitsch des Optimisten aus Glasgow war nicht nur für „schlichte Gemüter“ ein Ereignis – gefällig, kraftvoll und mystisch zugleich. Wo sonst wird heutzutage noch ein Auftritt zelebriert, als gelte es, die Welt zu retten? Sanctify yourself.