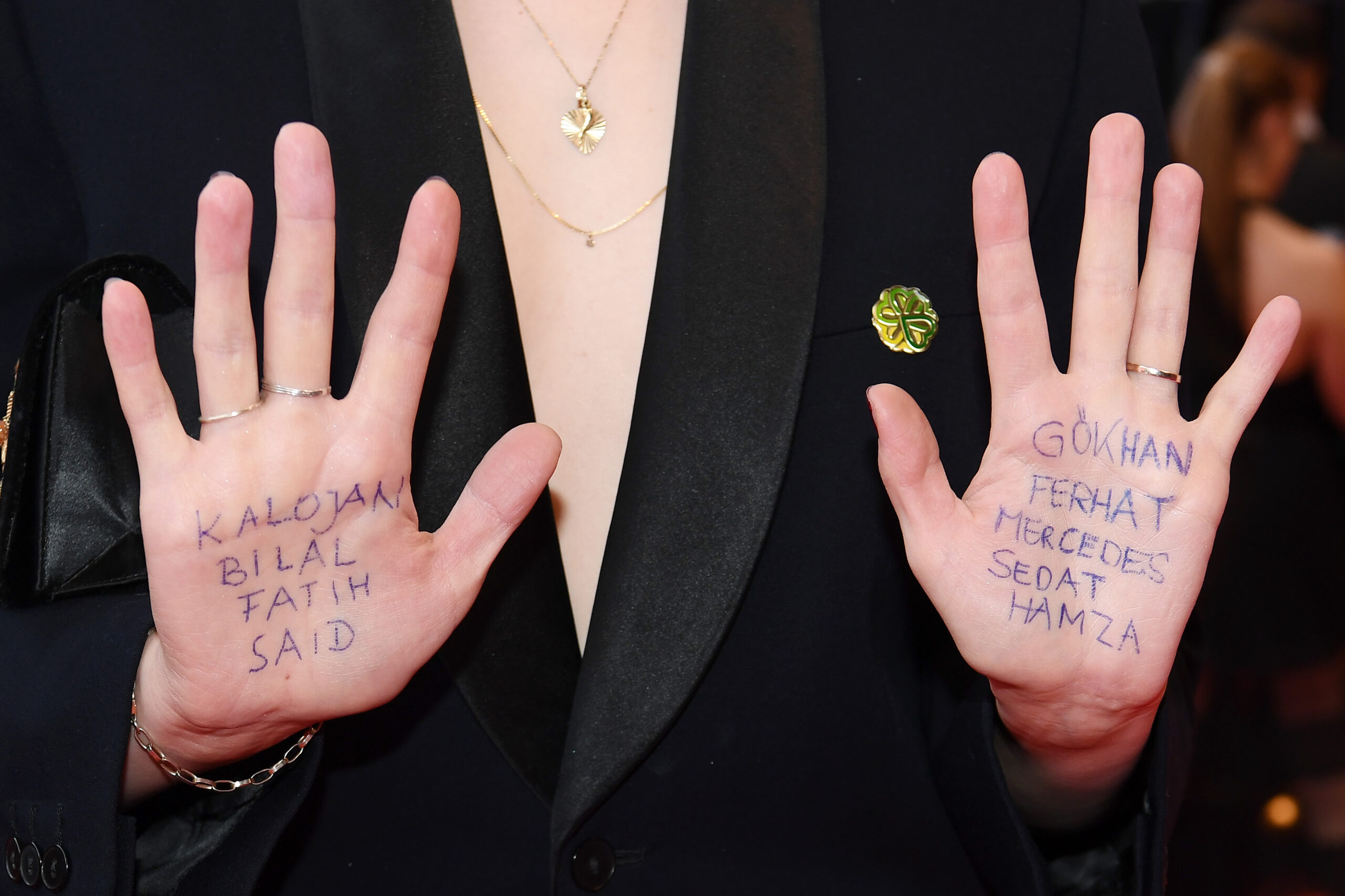Bob Marley erobert Deutschland
Was Bob Marley und seine Wailers im Verlauf ihrer '76-Tournee an positivem Feeling gesät hatten, konnten sie nun Mitte Mai 1977 reichlich ernten: Bei vier Konzerten in München, Heidelberg, Harmburg und Berlin tanzten fast 10.000 vom afrikanischen Fieber gepackte Leute zur Musik aus Trenchtown, Jamaica. Fäuste, Fahnen und Feuerzeug-Ovationen waren zu sehen. Die kleine, aber kräftige Pflanze Reggae war -Prinzip Hoffnung - nicht zu killen. Nicht bei solchen Gärtnern.
„Bei Unruhen im Humbold Park zu Chicago wurden zwei Puertoricaner erschossen.“ ,,10.000 schwarze Untergrundkämpfer warten in Mozambique und Sambia darauf, in Rhodesien einzumarschieren“. Die 1975 in der Dominikanischen Republik erlassenen Gesetze zur Bekämpfung der ‚Dreadlocks‘ sind erneut verschärft worden. “ „Hinter der deutschen Schule in Addis Abeba Äthiopien schmoren 16 ermordete Schulkinder in der Sonne“. „Ex-CIA-Mann Philipp Aglce machte auf einer Pressekonferenz allein 9 Agenten namhaft, die zur Zerrüttung Jamaicas eingesetzt sind“. „In Jamaica gibt es heute über 100.000 Rastas“. ,,Dem Massenmörder Idi Amin wird das Betreten englischen Bodens verwehrt“. „Beim karibischen Karneval im Londoner Getto Nottinghill Gate brachen im August 76 die schwersten Rassenunruhen seit 20 Jahren aus. “ (Nachrichten aus der Weltpresse). ,, Wir Afrikaner werden kämpfen“ (Bob Marley). „Das ist nur gute Tenzmusik, sonst nichts“ (deutscher Branchendienst „Rundy“ über Marleys LP „Exodus“.
Du denkst, du träumst. Vor einem Waffengeschäft in Heidelberg fachsimpeln lachend Robert Nesta Marley und ,,der Mann an der Niyabingitrommel‘, Bruder Seeco über diverse Gewehrmodelle. Dieselben Männer, die ein MP-Attentat gedungener Killer nur knapp überlebten.
Die Zottellocken waren zum zweiten Mal da, wie immer von „Natural Mystic“ umgeben. Wo sie hierzulande auftauchten, wurde knapp 100.000 verkauften Wailers-LPs in der BRD zum Trotz – die nicht nur kulturelle Kluft klar, die sich zwischen dem überschwenglich aufgelenen Getto-Rock und unserem eigenen Bewußtsein auftut. Leben ist halt nicht nur ein Rhythmusproblem. Eine der wenigen Brücken: der im Konzert auf uns weisende Zeigefinger von Marley zu der provozierend gesungenen Frage „Open your eyes and look within/Are you satisfied with the life life you’re livin’?“ Daß diese Musik Mut macht beim eigenen Befreiungskampf, jenen, die in den Betonsilos, nicht in den Wellblechhütten wohnen, war das Wichtigste, was blieb. Eine Perspektive, die die Pluttenindustrie, auch die meisten Medien, natürlich zu verleugnen wissen.
München, am 14. Mai, kurz vor Mitternacht: die Wailers und Rico, die fabelhafte Vorgruppe um den Posaunisten Rico Rodrigues, laufen ein, in nagelneuen Trainingsanzügen. In Marleys „Präsidenten-Suite“, wie immer Kommunikationszentrum für alle Musiker, wird sogleich gekocht. Die Farbröhre im heilen Germany, bringt (kosmisch natürlich) eine Sportübertragung aus Kingston.
Zahlen, nackt: pro Konzert erhielten die (mit Koch Gilly, Küchenhilfe Inez und Lichtzauberer Neville Garrick) 12 Rasta-Leute 4.000 Dollar. 3.000 steckte die englische Agentur ein, Hotels gingen extra. Das Programm, nackt: 11 Songs, Auftakt „Road Block“ (Rebel Music) „Them Belly Full“, „I Shot The Sheriff“. „No Woman No Cry“, „War“, „Burnin‘ And Lootin“, „The Heathen“, „Lively Up Yourself“. Als Zugabe „Get Up, Stand Up“ und „Exodus“. In Berlin zusätzlich „Jamming“, „Crazy Boldhead“, „Positive Vibration“ und eine lange Improvisation mit verschiedenen, zum Teil unbekannten Songzitaten.
Zitat, nackt: „Leute wie ich, Bauern, Hungerleider, die von der Straße, kennen die Wahrheit in meinen Liedern sowieso; jetzt seid ihr dran!“(Marley).
Die Nigger kommen
Pedaltretbootintermezzo im Münchener Englischen Garten: gepflegte Bürger zwischen gepflegtem Rasen, auf dem kleinen künstlichen See vier strampelnde, paffende schwadronierende Rastas; Drummer Carlton Barret und Bandleader Aston ‚Family Man‘ Barret auch hier perfekt im Takt. „Dem so fit,“ murmelt Neville, Cover-Entwerfer, Lichtmann und Produzent der Bühnenfahnen der Wailers, auf denen der 225. Statthalter der salomonischen Dynastie, Haile Selassie, und Black-Power-Prophet Marcus Garvey unerschütterlich thronen.
Hinten im Boot hockt Gilly, der (bongo kongo) Koch, die spinatgrünverspiegelte Sonnenbrille linst zwischen gewaltigen Dreadlocks hervor, den Kopf krönt über einem Kampftuch aus arabischen Nächten ein gigantischer Tropenhelm; Gilly, der in voller Montur während der Show neben dem hüpffrohen Organisten Tyrone Downie nichts als tanzt, ein vollgekiffter Bär auf Rollschuhen; Gilly, der uns später ein „Irish Moss“ mixt (lust- und kraftspendender Trank mit Eiern, verschiedenen Kräutern, Meeresalgen und wildem Honig), das den Magen vor Freude wimmern läßt. Am Ufer dazu ein deutscher Spaziergänger: „Kommen jetzt die Nigger bei uns auf Expedition?“ Aber auch bayerische Freaks, die laute „Reggae“ Rufe in den weißblauen Himmel jagen.
Im Zirkus Krone wehen die Löwen-Fahnen der Wailers genau über der Manege, wo im Winter die echten Raubtiere den Feuerreif bespringen. Ein Risenspiegel in den Stallungen hinter der Bühne wird von der Band für eine Konzession an eitle Elefanten gehalten. Einer der Rastas erinnert lautstark an den Afrikaner Hannibal, der mit seinen Elefanten nach gelungener Alpenüberquerung die „Romans“ fürchterlich schockte: beifälliges Gelächter aller Bandmitglieder.
Im ausverkauften Rundbau 3000 ausgelassene, aufgeregte Leut‘, ein seltenes Tohuwabohu, wie man es nur bei sogenannten „Kultkonzerten“ zu sehen bekommt: ganze Landkommunen mit Kindern auf den Schultern, Schwabinger Cineasten-Rocker, Polit-Clans mit schwarzem Anarchistenstern. Vor der Bühne haben sich hundert Hallodris um die Fahne eines bayerischen Kleinzirkus'(„Hundertfleck“) geschart und feiern ihr eigenes Tanzfest.
Ein Karate-Mann spielt Töne mit Biß
Die lOköpfige bläserbetonte Band um den Reggae-Jazz-Daddy Rico klingt zum Auftakt so, als habe man Chicago in Zeitlupe durch die tropische Hanfmangel gedreht, bluesig und cool. Beim (stärksten Titel – „Dial Africa“ schafft Rico die Kreuzung zwischen einem lässigen Eintänzer aus New Orleans und dem Posaunenengel des Jüngsten Gerichts.
Als Bob – der Off-Beat-Schamane – zu „Rebel Music“ auf die Bühne wippt, merkt niemand ihm den bandagierten Fuß an, Preis eines 18:6-Fußballsieges (für die Wailers natürlich) über die Island Records-Mannschaft („dem too much sales-meetings, mon“). Überhaupt: Rastas und Fußball, das klingt zwar wie Marx Brothers in der Oper, ist aber für die Akteure selbst eine ernste Sache. Fit sein wie Bruce Lee, Idol der Ghettojugend in Westkingston auf Jamaica. Fit sein wie Julian Marvin („Carl Palmer and I same Karate-teacher“), Ein sanfter Rebel, auch Junior oder Elias genannt, neuer, schneller, rockiger Gitarrist der Wailers. Man sollte sich seine Solos auf Stomufamash’ta’s „Go“-LP und auf der neuen Platte von Stevie Winwood mal anhören: Töne mit Biß! Fit sein schließlich wie ‚Man Skill Cole, Jamaikas Fuß-Dall-Idol und Marleys Freund. Kosmos New York bot ihm zwei Mille. Bedingung: er muß nur seine Dreadlocks abschneiden. Er pfiff drauf, lebt heute in Äthiopien und gibt dort Fußlallunterricht, mitten im Bürgerkrieg. Auch Marley will, er lagt es mehrfach, noch dieses fahr nach Afrika. Möglich auch, daß er den Heiden weiter die Botschaft des Rasta-Gottes Jah bringen muß, wer weiß das schon…
Die Wailers in Berlin: zweieinhalb Stunden Musik, 3000 Zuhörer
Marley bleibt der visionäre Botschafter einer besseren Welt, las haben diese vier deutschen Konzerte trotz angebrachter Skepsis belegt. Der Kommerz berührt seine Seele so wenig wie der drittklassige Brüllhals on Ansager im James-Brown Freistil, der in Deutschlands fallen glücklicherweise Pfiffe erntete. Klar wurde aber auch, wie sehr der Rastaman ein Publikum braucht, das zumindest mit ihm fühlt. Wie in Heidelberg, wo die Fäuste synchron mit den „politischen“ Textstellen hochflogen, wie in München, wo die Zuschauer, in sinnliche Veitstänze ausbrachen, ihr Konzert machten.
Und wie in Berlin. Dort gaben die Wailers ihr bestes und längstes Konzert, 2 Stunden, 20 Minuten. Marley raste wie in Trance über die Bühne, intonierte endlose Scat-Reihungen, neue Texte, holte sich von den 3000 den gemeinsam gesungenen Satz „Set the captives free“ – Freiheit für die Gefangenen -, umarmte die I-Threes zu einem bewegenden Gospel-Chor, lachte, als 200 Leute trotz vieler Bullenmannschaftswagen die Halle stürmten (FREE!) und hätte wohl nicht aufgehört („now, we do it all nite long!“), wenn ihn der besorgte Manager Don Taylor nicht mit sanfter Gewalt von der Bühne gezogen hätte. Was für ein Kontrast zu Hamburg, wo in der tristen Viehhalle (die Hanseaten sagen „Ernst–Merck-Halle“ dazu) nichts kochte. Aber das lag wohl an der Halle, und nicht an den 2000 Hamburgern.
Marleys Botschaft: Befreit Euch selbst!
Ras de Silva: „Die Zeit ist gekommen, in der die schwarze Jugend begreifen muß, daß wir als Sklaven aus Afrika verschleppt worden sind. Heute haben wir die Ketten nicht mehr an unseren Füßen, sondern an unserem Geist.“
Bob Marley artikuliert dieses neue Roots-Gefühl der Schwarzen in aller Welt derzeit wie kein zweiter. Was uns betrifft, in den weißen Industriestädten: er hilft uns, die eigenen Wurzeln wiederzuentdecken, fordert zum „Exodus“ aus unseren geistigen Ghettos auf. Außerdem: auch wir haben für unsere Rechte zu kämpfen, blickt euch um! Es ist, wie der alte Hopi-Indianer zu dem Weißen sagte, der ihn nach einer Möglichkeit zur Unterstützung des indianischen Kampfes fragte. Der Hopi sagte: „Befreit Euch selbst!“.