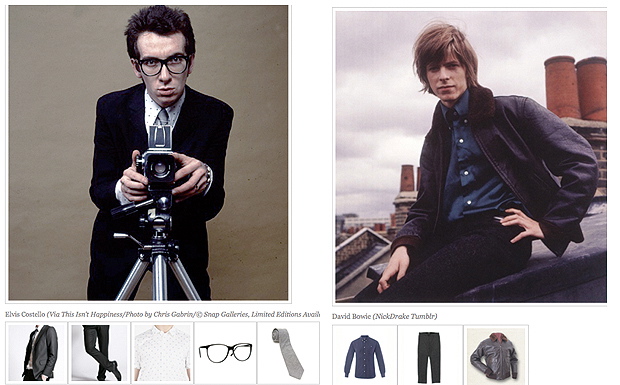Bryan Ferry: Viva Las Vegas
In einem luxuriösen Spielcasino in Lissabon probt Bryan Ferry bei Lachs und Lobster den Dandy-Schick seiner Deutschlandtournee im September.
Es hat schon ein bisschen was von Las Vegas. Im „Auditóro“ des „maior Casino da Europa“, dem „Casino Estoril“ in einem Nobel-Vorort von Lissabon, sitzt die High Society der portugiesischen Hauptstadt beim Galadinner (nur 100 Euro pro Person) im Halbdunkel an kleinen Tischen mit pseudo-antiken Lämpchen. Herren mittleren Alters, die Wohlstandsbäuche in maßgeschneidertes Tuch gehüllt, und ihre teuren Frauen in Cocktailkleidchen schieben sich Shrimps, Lobster und andere wirbellose Tiere, denen der Schreiber dieser Zeilen lieber im Atlantik begegnen würde als auf seinem Teller, zwischen die jacketgekrönten Zähne. Oben auf der Bühne hat derweil Bryan Ferry mit Bob Dylans „It’s All Over Now Baby Blue“ seinen Auftritt begonnen. Das Publikum aber kümmert sich lieber um das als Delikatesse geltende Meeresgetier als um den performenden Künstler. Genau diese Szenerie muss Bob Dylan damals im Sinn gehabt haben, als er diesen Song geschrieben hat.
Eine Stunde vorher: Eine weiße Stretch-Limousine hält vor einem Springbrunnen im Park des Casinos, um dem offensichtlich sehr wichtigen Insassen ein offensichtlich sehr interessantes Spektakel zu präsentieren: Der Springbrunnen sprüht kurz darauf von Laserlicht benetzte Wasser-Fontänen in alle Himmelsrichtungen, und aus unterdimensionierten Lautsprecherboxen krächzt die „Ode an die Freude“ aus Beethovens Neunter Symphonie. Derweil stehen zwei Dutzend Touristen dumm herum und können sich nicht so recht entscheiden, wem sie mehr Aufmerksamkeit widmen sollen, den Wasserspielen oder der Berühmtheit, deren Identität hinter den getönten Scheiben in der Limousine noch im Dunkeln bleibt. Als das Schauspiel vorbei ist, öffnet ein Angestellter in Livree die Wagentür, und aus dem Fond steigt Bryan Ferry im hellen Anzug, um ganz ganz schnell im Inneren des Gebäudes zu verschwinden.
Ferry, mittlerweile im kleidsamen schwarzen Lederanzug, und seine elfköpfige Band – darunter Roxy Music-Schlagzeuger Paul Thompson sowie Langzeitpartner und Gitarrenlegende Chris Spedding – geben sich alle Mühe, vor einem Publikum, dem es prinzipiell egal ist, ob Diana Ross, Liza Minnelli, Ray Charles oder Jose Carreras die Hintergrundmusik zu ihrem Dinner geben, eine richtige Show zu bieten. Aber Ferry ist ja selber schuld. Der 56-Jährige hat vor dreißig Jahren die Kunstfigur Bryan Ferry erfunden, den gelangweilten, kultivierten, immer gut gekleideten Dandy, der gelangweilt auf langweiligen Dinnerpartys rumhängt. An diesem Abend fährt er die Ernte ein, die er damals gesät hat, und bekommt das Publikum, das er verdient. Menschen, die den wohl designten Handlungen von Designersongs wie „Love Is The Drug“, „Slave To Love“ oder „Let’s Stick Together“ entsprungen sind. So wundert es auch nicht unbedingt, dass das Programm mehr aus Ferrys Dandy-Repertoire schöpft als aus den eher komplexeren frühen Roxy Music-Kompositionen: „Oh Yeah“, „Dance Away“, „Jealous Guy“, „Can’t Let Go“, früher bis mittlerer Roxy Music-Stoff für Besserverdienende („Out Of The Blue“, „Do The Strand“, „Virginia Plain“, „Both Ends Burning“) und zwei weitere Bob-Dylan-Covers („Don’t Think Twice“, „A Hard Rain’s A-Gonna Fall“).
Unterdessen ist das Publikum aus dem Verdauungsschlaf aufgewacht. Es gibt die ersten Emotionsausbrüche – in Form von zwei Rufen. Grund: „Slave To Love“. Das kennt man, das liebt man, schließlich hat man ja damals „9 1/2 Wochen“ gesehen. Bryan Ferry ist auf dem besten Weg, ein moderner Frank Sinatra zu werden. Er lebt von Songs aus der Vergangenheit, eigenen und fremden, ist mehr Performer als Songschreiber. Wie er etwa Dylans „Don’t Think Twice“ von seinem „Frantic“-Album wunderschön umdeutet, hat das durchaus große Entertainer-Qualitäten. Nur zu Piano- und zur (eigenen) Mundharmonikabegleitung macht Ferry den Song zu seinem Eigenen, ohne das Original zu schänden.
Ansonsten hat der Entertainer eine hervorragende Band im Rücken, mit – allen voran – Lucy Wilkins an Violine, Cello und Keyboards sowie dem überragenden Chris Spedding, der mit seinem Slide-Gitarren-Solo in „Both Ends Burning“ die letzten Lobster vom Teller verscheucht. Dann, bei „Dance Away“, erreicht die Stimmung langsam Konzert-Normalmaß. Da werden Erinnerungen wach an die achtziger Jahre, als der Champagner noch in Strömen floss, der Kaviar tonnenweise im Keller einlagerte und „Rezession“ ein Fremdwort war.
Als Bryan Ferry nach zwei Zugaben („Love Is The Drug“, „Do The Strand“) die dritte verweigert, zeigt sich, dass auch Millionäre ganz normale Menschen sind, mit ganz normalen Gefühlen und Bedürfnissen: das Publikum spendet minuten(!)langen Applaus und vereinzelte Pfiffe. Aber Herr Ferry lässt sich nicht erweichen. Es ist die Zeit für die oberen Zweitausend gekommen, im Foyer die Cohiba zu entzünden und den Gesellschaftsfotografen das makellos präparierte Gebiss zu präsentieren. Derweil sitzt Ferry schon wieder im Fond der Stretch-Limo und sinniert vielleicht über seine Altersversorgung nach. In fünzehn, zwanzig Jahren als der elder statesman der gepflegten Popmusik zwischen dem „Casino Estoril“ und „Caesar’s Palace“ in Las Vegas pendeln. Das wäre doch was.
www.bryanferry.com