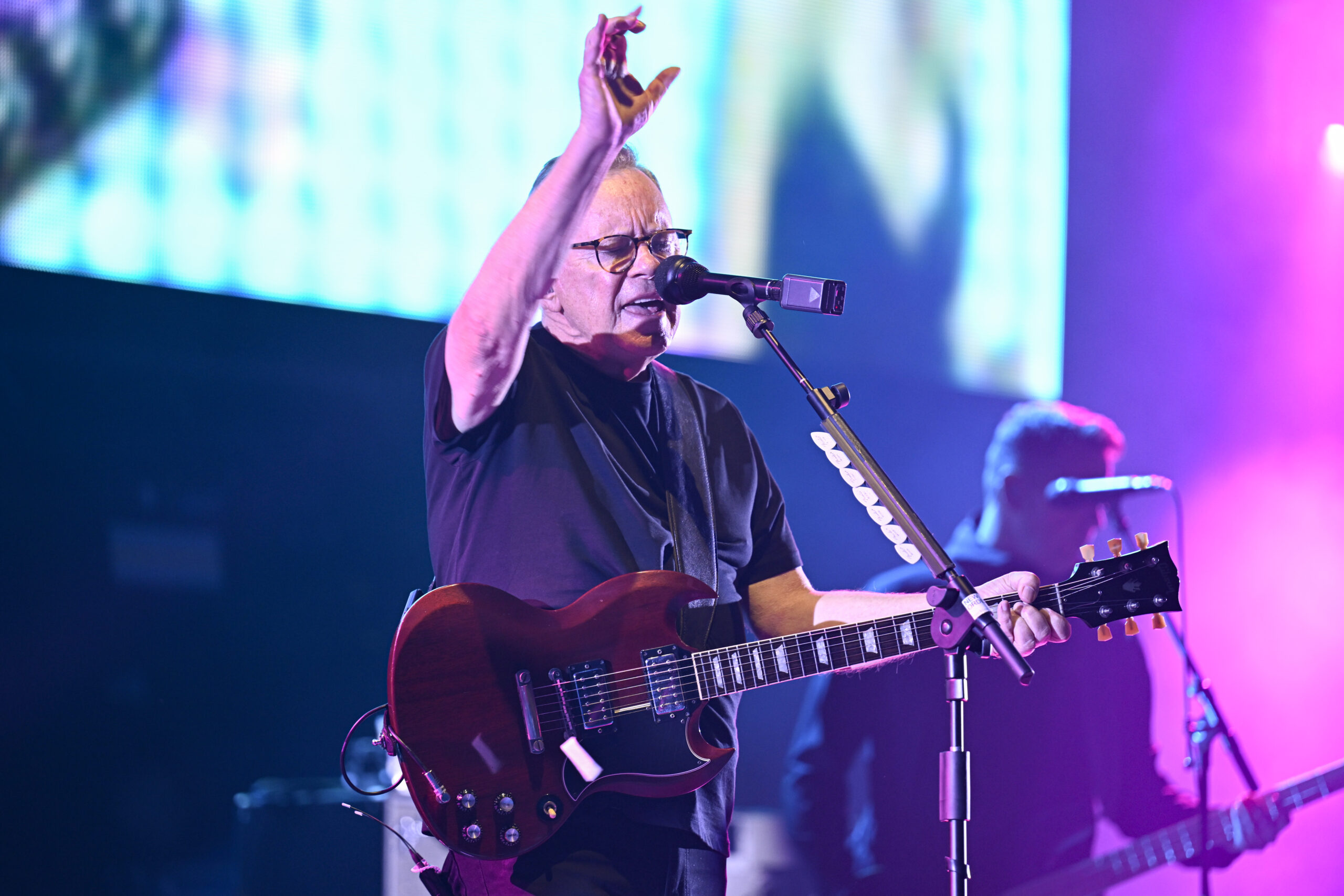Kurz & Klein
Fraglich, ob man noch den Begriff „lang erwartet“ bemühen sollte, wenn Alanis Morissette ihr erstes Album mit neuem Songs seit vier Jahren veröffentlicht. Am 30. Mai kommt es jedenfalls in die Läden. Es trägt den Titel flavors of entanglement (Warner), und ein großer Teil der Tracks darauf gibt sich etwas „ethnomäßig“ und „spirituell“ – das kommt bei Popstars jenseits der 30 gerne mal vor – und erinnert ein bisschen an Robert-Plant-Soloplatten aus den 90ern mit ihrem Nebeneinander von „nordafrikanischen“ Grooves und Hardrock-Gitarren. Was an sich ja nicht das Schlechteste ist. Leider strahlt Alanis, die sich im vergangenen Jahr mit ihrem „My Humps“-Video auf YouTube mal so wunderschön selbst auf die Schippe genommen hat, in ihrem Gesang eine so komplett humorfreie Bemühtheit aus, die beim als selbstironisch bekannten Plant nie vorkäme. Zudem war der Produktionsaufwand der elf Tracks zwar hörbar hoch, ihr melodischer Merkwert ist dafür leider eher mäßig – wenn man mal die beiden Pianoballaden „Not As We“ und „Toren“ ausnimmt. Das klingt alles so „decidedly nineties“ – ob die Kanadierin damit auch andere Hörer als ihre Fans aus der vergangenen Dekade erreicht?
Auch Herwig Mitteregger hat schon mal eine zentralere Rolle in der Welt des Pop gespielt als heute. Nämlich in den 80er Jahren als Sänger, Schlagzeuger und Songschreiber bei Spliff, als er noch so wunderbare Zeilen textete wie „Der rote Hugo hängt tot im Seil/seine Leiche stinkt nach Shit“. Nach langer Vaterschaftspause meldet er sich jetzt mit insolito (Manoscrito music/Edel) im Musikbetrieb zurück. Mitteregger hat sein Comebackwerk selbst produziert und das war vielleicht keine ganz so gute Idee: Seine stellenweise immer noch lesens- und hörenswerten Texte ersäuft er in allerlei handelsüblichem elektronischem Studio-Schnickschnack, den er vermutlich für modern hält. Ab und an dürfen dann schreckliche Studiomucker-mäßige L.A.-Style Schweinerock-Gitarren und Diabeteserregende 80s-Sax-Garnierungen dazu kommen. Zu schade, denn der Mann hätte ja eigentlich hübsche melancholisch-lakonische Geschichten zu bieten.
Die italienische Popszene spielt im Musikmagazin Ihres Vertrauens seit einiger Zeit begründetermaßen keine große Rolle, und nur selten schaffen es derzeit italienische Musiker, in den für den ME relevanten Genres international wahrgenommen zu werden. Giovanni Ferrario ist einer dieser seltenen Fälle. Der in seinem Heimatland seit gut einem Jahrzehnt als Live- und Studiomusiker bekannte Gitarrist hat zuletzt immerhin auf Einladung von Produzent John Parish am demnächst erscheinenden neuen PJ-Harvey-Album mitgewirkt. Sein Soloalbum headquarter Delirium (Solaris Empire/Broken Silence) lässt erahnen, warum, entpuppt sich als durchaus eher britisch klingende Angelegenheit: Was Ferrario da mit einem dunklen Tenor in beachtlich akzentfreiem Englisch intoniert, erinnert nicht nur stimmlich an die Soloalben des Van-der-Graaf-Generator-Gründers Peter Hammill, gelegentlich auch an die stilleren Bowie-Momente. Sehr erwachsener, nachdenklicher, meist eher dunkelgrau gestimmter Songwriters Rock mit feinen, meist eher subtil als plakativ ausgespielten Arrangement-Ideen, der mit den bei uns gängigen Klischees über Italorock aber auch gar nichts gemein hat.
Aus dem derzeit popmusikalisch so hoch gehandelten Seebad Brighton kommen The Miserable Rieh. Auf ihrem Debütalbum 12 ways to count (Hazelwood/Indigo) offerieren sie einen zarten, alle möglichen Schattierungen melancholischer Stimmungen widerspiegelnden streicherverbrämten Kammer-Folkpop, der wunderbar zum Herbstlaub auf ihrem Albumcover passt (dieses wiederum aber vielleicht nicht ganz so optimal zum Veröffentlichungstermin). Diese Songs sind entschieden unspektakulär, gewinnen aber bei jedem Hördurchgang.
Ähnliches gilt auch für die Songs der 33-jährigen Amerikanerin Sera Cahoone auf deren zweitem Album only as the day is long (Sub Pop/Cargo). Die Sängerin und Gitarristin, die eine Zeit lang als Drummerin bei der Band Of Horses aktiv war, steht mit beiden Beinen auf dem sicheren Fundament der American Roots. Ihre getragenen, sehnsuchtsvoll melodiösen Songs rufen Assoziationen an nächtliche Fahnen durch die Weiten des Mittleren Westens wach. Sie sind in luftige Arrangements gepackt, die sich hauptsächlich im Folk, aber auch in Country und Blues bedienen und zu sorgfaltig aufgenommen sind, um als LoFi eingestuft zu werden. „Country Noir“ nennt das das Label, doch so düster kommen diese Balladen gar nicht daher, eher träumerisch und wohlig-melancholisch. Wer mit der Musik von Sophie Zelmani oder der Cowboy Junkies etwas anfangen kann, sollte sich unbedingt mal mit Sera Cahoone beschäftigen.
Irgendwie nokturne Angelegenheiten verspricht auch Christopher D. Ashley indirekt mit dem Titel und der Covergestaltung seines Debütalbums cruel romantics (Sunday Best/Rough Trade). Was der Sohn eines englischen Vaters und einer mittelamerikanischen Mutter darauf anbietet, sind kompakte Popsongs ganz in der Tradition großer 80er Synthiepop-Bands wie Depeche Mode und New Order. Diese Songs über zerbrochene Beziehungen und Drogenprobleme kommen in der Tat in Wort und Klang hinlänglich sinister daher, können aber dem Vergleich mit den großen Vorbildern begreiflicherweise nur in wenigen Momenten standhalten.
Mit so einem Problem hat auch die Berliner Band Erikt Me auf ihrem Zweitling hundertsechzig zeichen (Revolver/ Soulfood) zu tun. Die Musiker um den 33-jährigen Gitarristen, Sänger und Songschreiber Erik Lautenschläger tummeln sich mit ihrem schwelgerisch-melodieverliebten Träumerpop in den Gefilden von Coldplay, Keane und Starsailor, nur ist ihr Sound noch verhuschter, zarter. Da wird viel mit akustischem Instrumentarium gearbeitet und in den Texten von großen Gefühlen geflüstert – wie gut man das als Hörer verträgt, hängt trotz manch hübscher Arrangementidee in erheblichem Maße davon ab, ob man die öfter mal im Überschwang der Emotionen vom Tenor in den Alt kippende Stimme Laurenschlägers nun als „verletzlich“ oder als „weinerlich“ empfindet.
Da sind die drei Brüder Tom, Dylan und Olly Gorman, die sich zusammen Kill The Young nennen, von ganz anderem Schrot und Korn (lässt der Bandname ja auch vermuten). Als Einflüsse führen die jungen Herren aus Manchester Sonic Youth, Nirvana, New Order und Led Zeppelin an. Auf ihrem zweiten Album, das sie mit Mut zum Risiko proud Sponsors of boredom (Discograph/Rough Trade) betitelt haben, gelingt ihnen eine mitunter ästhetisch bedenkliche, dafür aber gar nicht mal so langweilige Melange aus Indie und härterem Rock mit cleveren Hooks und gelegentlichem Emo-Einschlag. Das könnte hierzulande durchaus einige Freunde finden, wenn Kill The Young weiter so fleißig auf Festivals spielen wie in den letzten Jahren.