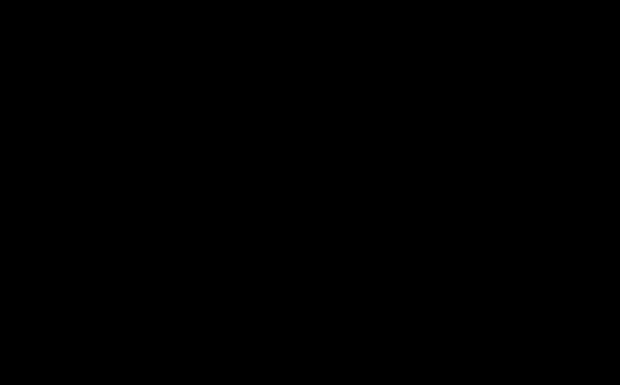Brian Jones: The Last Decadent :: Rastlos
Schon häufiger ist es erzählt worden, das Leben des Brian. Da wurde der Ur-Stone dann als identitätsstiftender Rebell der Beat-Ära gefeiert und als Trip- und Pillenfreak porträtiert, dessen maßloser Konsum ehrfurchtgebietende Ausmaße überschritt. Auch als ingeniöser Multi-Instrumentalist wurde er stets beschrieben, sowie als paranoider Schlimmfinger, der, von Mick, Keith und Anita Pallenberg verlassen, schließlich als Burn Out von der Bühne abtrat. Vor allem sein in der Tat mysteriöses Ableben im Swimming Pool rief die Biographen auf den Plan, die dem geneigten Leser gar Einblicke in den Autopsiebericht gewährten. Seither wissen wir, wie viel Barbiturate in Brians Blase blieben, oder daß seine voluminöse Leber zum Zeitpunkt des Ablebens mit gerade mal 1,4 Promille Alkohol beschäftigt war. Auch Jeremy Reed erzählt all diese Dinge, wobei die Innereien außen vor bleiben – Gott sei Dank. Doch Reed geht einen Schritt weiter, er zieht durchaus statthafte Vergleiche zu anderen Bonvivants und Exzentrikern wie Oscar Wilde, Count Eric Stenbock oder Baudelaire. Statthaft deshalb, weil Jones tatsächlich ein Dandy in bester Tradition war, selbstverliebt, stilbewußt, sensibel und gebildet, verschwenderisch und exzessiv bis zur Selbstzerstörung sowie sexuell in alle Richtungen überaus aktiv. Ein Genußmensch im „Swinging London“, dessen Dekadenz auch die hartgesottenen Schreiber im alten Rom inspiriert hätte. Das ist unterhaltsame Lektüre, die sich vom lahmen Sex & Drugs & Rock ’n‘ Roll-Klischee intellektuell wohltuend entfernt. Ob seine gelebte Bisexualität – und angeblich unterdrückte Homosexualität – tatsächlich so viel zum Niedergang von Brian Jones beigetragen hat, wie Reed darlegt, sei einmal dahingestellt. Doch immerhin zeichnet der Autor ein runderes Bild von Jones, als es seinen Vorgängern bislang gelungen ist: keine allzu plumpe Heldenverehrung, kaum Verschwörungstheorien, kein Reduzieren auf zu viele Drogen, eine schlimme Paranoia und den noch immer ungeklärten Abgang im Pool. Statt dessen das Porträt eines widersprüchlichen, rastlosen Charakters, der trotz lebenszeitsprengender Erfahrungen unreif blieb. Und die sechziger Jahre wohl eindringlicher symbolisiert als „Hair“, Woodstock und Mary Quant.
Mehr News und Stories