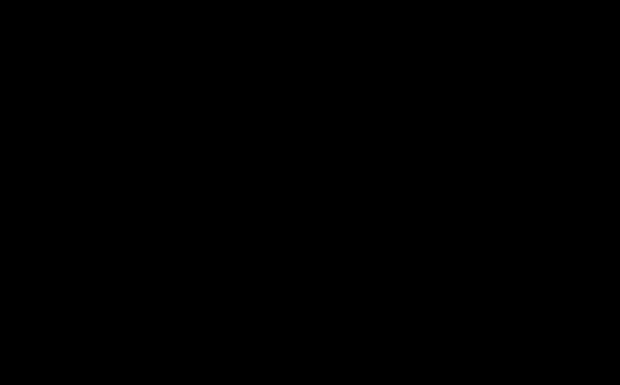Rolling Stones: Dirty Work
Vor 40 Jahren, am 12. Juli 1962, gaben die Rolling Stones im Londoner Marquee-Club ihr erstes Konzert. Wir gratulieren Jagger, Richards & Co. zu diesem runden Geburtstag und werfen einen kritischen Blick auf die Musik hinter dem Mythos.
Come On (1960-63)
„Sie alle fanden irgendwann ihre musikalische Identität. Und ihr gemeinsamer Startpunkt war der Blues.“
So war es wohl. Der das sagt, muss es wissen, John Mayall kannte sie alle, die in den frühen 60er fahren in London dem Blues verfielen. Leute wie Eric Clapton, Peter Green und Mick Taylor gingen durch Mayalls strenge Bluesbreakers-Schule. Andere lernten beim kosmopolitischen Halbgriechen und Szeneguru Alexis Korner und dessen Blues Incorporated. Dazu gehörten auch ein paar Vorstadtbengel, aus denen bald schon die Rolling Stones werden sollten.
Die Alben, die der 16-jährige Mick Jagger der Legende nach im Oktober 1960 auf dem Bahnsteig in Danford unterm Arm hielt, als er seinem Sandkastenkumpel, dem etwa gleichaltrigen Keith Richards, erstmals wieder begegnete, sollen Chess-Importe von Chuck Berry, Muddy Waters und Little Walter gewesen sein – womit die musikalische Hausnummer, bei der Jagger/Richards ansetzten, exakt umschrieben ist. Während Mick auf authentischen Chicago Blues stand, hatte Keith überdies ein Faible für Chuck Berry. Aber das Dartford Delta liegt nun mal nicht am Mississippi, sondern an der Themse, und da gibt es Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre noch jede Menge anderes zu hören: Unterhaltungsschlager in der Tradition der allen Vaudeville- und Dancehall-Tage, gelegentlich mit leichtem Comedy-Einschlag. Dazu jede Menge Traditional Jazz von Koryphäen wie Chris Barber und Acker Bilk, ein wenig Skiffle mit Lonnie Donegan und vereinzelte, noch unbeholfene Versuche, den originalen US-Rock’n’Roll fürs Königreich zu adaptieren. Dieser Musikstil wird jedoch schon als Schnee von gestern betrachtet, seine wichtigsten Protagonisten wie Chuck Berry, Elvis und Jerry Lee Lewis sind weg vom Hit-Fenster. Pop ist 1960 „zickiges Zeug“, wie Alexis Korner einst bemerkte, das der jungen Nachkriegsgeneration nichts sagt, das mehr mit der Heile-Welt-Sehnsucht ihrer kriegsgeprüften Filtern zu tun hat als mit ihnen selbst. Da sind der schwermütige Blues eines Muddy Waters, der elegante Drive, mit dem Chuck Berry seine clevere Teen-Lyrik vertont, und der anarchische Dschungelbeat eines Bo Diddlev von anderem Kaliber hier geht’s ums wirkliche Leben, auch wenn die Jungspunde in ihren tristen englischen Vorstädten davon noch kaum etwas wissen. Aber sie spüren, dass dieses Zeug echt ist. Und aufregend.
Auftritt Brian Jones: Ihn finden die Bluesjünger Jagger und Richards im April ’62 auf der Bühne des Marquee-Club, wo der schon 20-jährige Blondschopf aus Cheitenham als Slide-Gitarrist Elmo Lewis mit Bluesdaddy Alexis Korner auf der Bühne steht. Man freundet sich an. Mick und Keith bewundern den Outlaw Jones maßlos. Und der willigt ein, mit ihnen seine eigene, puristische Bluesband zu gründen. Das Apartment, das sich die Drei kurze Zeit später in der Edith Grove teilen, wird zum Blueskloster, wo die reine Lehre gelebt wird. Monatelang werden Licks, Harmonien und Riffs der amerikanischen Vorbilder seziert. Und am 12. Juli ’62 geben die Enthusiasten im Marquee ihr Live-Debüt, erstmals unter dem Namen Rolling Stones. Neben Jagger, Jones, Richards und Pianist Ian Stewart stehen Bassist Dick Taylor (später bei den Pretty Things) und Aushilfs-Drummer Mick Avory (später Kinks) auf der Bühne. Das Repertoire umfasst Standards wie „Kansas City“, „Hoochie Coochie Man“ und „Bright Lights Big City“, aber auch Obskures wie den wenig bekannten Rocker „Down The Road Apiece“ aus dem Fundus von Chuck Berry. Der Kern der Band steht, allerdings wird Bill Wyman wenig später Taylor ersetzen. Im Januar 1963 stößt Charlie Watts als fester Drummer dazu. Inzwischen hat sich das Sextett vor allem durch seine fulminanten Sonntagsnachmittags-Auftritte im „Crawdaddy Club“ des Station Hotel in Richmond eine Gefolgschaft erspielt. Und eines Tages riecht der unternehmungslustige Allround-Hipster Andrew Oldham den Braten, nimmt die ungehobelte Rabaukenbande unter Vertrag und verschafft ihr einen Plattendeal. Ab jetzt ist die Geschichte der „Greatest Rock’n’Roll Band On Earth“ lückenlos dokumentiert.
Confessin‘ The Blues (1966)
Die frühen Stones sind noch ganz die ehrfürchtigen Jünger der großen US -Vorbilder. Ihr Bühnenrepertoire speist sich fast ausschließlich aus Chicago Blues, klassischem Chuck Berry, R’n’B und frühem Soul, dem sie neben naivem Enthusiasmus vor allem eine gehörige Portion Rotzigkeit und Aggressivität zufügen. Und noch etwas unterscheidet die Stones von der Konkurrenz: Intuitiv verändern sie die Vorlagen, bis sie ihnen „passen , überführen die fremden Songs in ihr eigenes Vokabular, filtern die U S -Kultur durch die graue britische Nachkriegswirklichkeit. Dabei kopiert Jagger den Südstaaten-Slang bis zur Lächerlichkeit. So kindisch diese anmaßende Ich-bin-ein-armer-Nigger-Attitüde aus der großen Klappe des blässlichen Grünschnabels zunächst auch scheint, so attraktiv wirkt die raue, energetische Musik auf das begeisterungsfähige englische Teen-Publikum.
Zwar haben die Beatles wenige Monate zuvor diese Rocklawine losgetreten, allerdings ist ihr Beat braver, ihr Image cleaner und ihr Streben klar auf den Popmarkt gerichtet. Die Stones sind zwar musikalisch zunächst unbedarfter als die Kollegen aus Liverpool, dafür graben sie umso tiefer in den Schätzen der schwarzen Musik. Jagger gibt den Blues-Missionar, predigt das Wort und mimt den Sexprotz („I’m A King Bee“). Wo die Beatles spielen, machen die Stones Lärm, wo die Beatles lächeln, grinsen die Stones hinterhältig (wenn sie denn überhaupt mal lachen). Wo die Beatles ihre Gitarrenarrangements am Vorbild von Buddy Hollys cleanen Crickets orientieren, klauen die Stones ihre Licks bei schwarzen Gitarristen wie Jimmy Reed, Elmore James und Chuck Berry, übernehmen deren ruppigen Sound und scheren sich kaum um die Aufteilung von Rhythmus- und Leadgitarre. Am deutlichsten wird der Unterschied an „I Wanna Be Your Man“. Bei den Beatles gerät das Lennon/McCartney-Original zum harmlosen Albumfüller mit lustigem Chorarrangement, braver Ringo-Leadstimme und ebensolchem Beat. Bei den Stones, die den Song nach der mäßig geglückten Chuck- Berry -Adaption „Come On“ als zweite Single veröffentlichen und damit im November ’63 auf Platz 12 der UK Top Ten landen, dominieren eine bedrohliche Slide-Gitarre, die hektisch treibende Rhythmusgruppe sowie Jaggers nöliges Gebell. „I Wanna Be Your Man“ die Beatles möchten ein Date, die Stones, keine Frage, wollen Sex.
Auf dem ersten Album, „The Rolling Stones“, erschienen im April ’64, gibt’s denn auch jede Menge US -Originale zu hören. Willie Dixons „I Just Wanna Make Love To You“, Rufus Thomas‘ „Walking The Dog“, Bo Diddleys „Mona“ sowie Berrys „Oh Carol“ aber auch Eigenes, etwa den zähen und linkischen Akustikgitarren-Herzschmerz „Tell Me“. Bei aller Energie und Frische, die das Album noch heute ausstrahlt, es leidet unter der amateurhaften Produktion kein Wunder, das Regent Studio war nach Keith Richards‘ Worten „ein kleines Hinterzimmer mit Eierkartons an den Wänden“. Aufgenommen wurde dort auf einer 2-Spur-Revox. Von den großen Plattenfirmen unabhängige Studios gibt es in jenen Tagen kaum, und Personal, das mit der Aufnahme elektrisch verstärkter Musik vertraut ist, schon gar nicht. Eine Schallplattenaufnahme ist Sache von Technikern, die selbst in den EMI-eigenen Abbey Road-Studios ihren Job im weißen Arbeitskittel erledigen.
Oldham will seine Schützlinge so schnell wie möglich als Teil der so genannten „britischen Invasion“ sehen, die gerade mit den Beatles als Eisbrecher und jeder Menge anderer Bands über die USA schwappt. Also folgt schon im Juni ’64 die erste US-Tour. Nur: Auf die Stones hat da drüben niemand gewartet. Man hat genug mit den fröhlichen Fab Four, den kuscheligen Herman’s Hermits und der kumpeligen Dave Clark Five – wer braucht da die rüden Blues-Apostel um Jones und Jagger, die noch dazu erheblich längere Haare tragen und in Straßenkleidung auftreten? Der Empfang ist entsprechend frostig. Und doch beschert diese erste US-Reise den Stones ein Erlebnis von geradezu religiöser Kraft. Am 10. und 11. Juni dürfen sie in den geheiligten Hallen der Chess Studios in Chicago aufnehmen. So haben sie auf der Rückreise fette Beute im Gepäck: „Around And Around“, „I Can’t Be Sarisfied“, „It’s All Over Now“ und „Empty Heart“ zeigen die Band nicht nur als kompakte Einheit und geschmackssichere Interpreten schwarzer Originale, sie klingen auch heute noch kraftvoll und ohne jede Patina.
Erstmals hat der Stones-Sound echte Autorität, und verantwortlich zeichnet dafür Chess-Engineer Ron Malo, der ansonsten mit all den großen Vorbildern wie Muddy Waters und Willie Dixon arbeitet. Und: Erstmals zeigt sich hier die Fähigkeit der Stones, die Talente anderer anzuzapfen und für die eigenen Interessen einzusetzen, ein Phänomen, dem wir in den kommenden Jahrzehnten noch häufig begegnen werden. „It’s All Over Now“ erscheint im Juni ’64 und wird prompt in Großbritannien zur ersten Nr. 1 der Gruppe. Fünf Songs des Chess-Materials werden auf der grandiosen EP „Five By Five“ veröffentlicht, der Rest zum großen Teil auf dem zweiten Album verbraten („No. 2“, in UK im Januar ’65 veröffentlicht, mit erheblich anderem Tracklisting in den USA drei Monate zuvor als „12 x 5“ erschienen).
Zum zweiten wichtigen US-Stützpunkt werden die RC A-Studios in Hollywood, wo die Band mit dem Toningenieur Dave Hassinger und dem Produktionstausendsassa Jack Nitzsche ab September ’64 bis August ’66 einen Großteil ihres Materials einspielt. Zwar ist Andrew „Loog“ Oldham auf allen Stones-Alben bis einschließlich „Between The Buttons“ als Produzent vermerkt, jedoch hat der Stones-Manager in den frühen Jahren eingestandenermaßen keine Ahnung vom Plattenmachen, eher fungiert er als Spiritus Rector der Veranstaltung. Was die musikalische Chemie betrifft, so agiert die Band schon in dieser frühen Phase eigenverantwortlich. Vor allem Richards und Jagger lernen dabei schnell von den erfahrenen Profis Malo und Hassinger. Allen voran aber beeinflusst Phil Spector, damals auf dem Höhepunkt seines Ruhms, die jungen Stones. Er ist zwar nur gelegentlicher Zaungast bei den Sessions, ermutigt die Briten aber zum nötigen „Think Big“. Spectors Großkotzigkeit ermuntert vor allem Oldham zu grenzenloser Arroganz gegenüber der Plattenindustrie. Eine Haltung, die seinen großen Coup vom November 1964 erst möglich macht: Statt wie alle anderen mit einer flotten, tanzbaren Single ins Weihnachtsgeschäft zu starten, bringen die Stones einen langsamen, noch dazu spartanisch produzierten Blues. Unerhört, aber sie kommen damit durch. „Little Red Rooster“ mit Brian Jones‘ markanter Slidegitarre und Jaggers klagender Harp steht eine Woche nach Veröffentlichung auf Platz 1 in England – triumphaler Abschluss der frühen Steinzeit. Die Band ist nun endgültig in der Spitzengruppe der damaligen Szene etabliert. Eines müssen die Rolling Stones indes noch lernen, bevor sie sich wirklich mit den vier fabelhaften Kollegen messen können: Sie müssen ihre Hits selber schreiben.
Get Off Of My Cloud (1965-66)
Songs haben Jagger und Richards zwar schon sehr früh geschrieben, allerdings taugt ihr Material bislang allenfalls für Albumfüller. Ob Jagger/Richards respektive Oldham Brian Jones bewusst als Komponisten blocken oder ob der schlicht nichts zu bieten hat, bleibt bis heute umstritten. Fakt ist jedoch, das Mick’n’Keith ab 1965 nicht nur veritables Hitmaterial zustande bringen, sondern plötzlich Klassiker um Klassiker absondern.
Den Anfang macht im Februar ’65 „The Last Time“ eine eigentlich simple Melodie, eingebettet in eine Allerwelts-Harmoniefolge und damit prototypisch. Aber das ist es nicht, was den Song groß macht: Es ist das Talent der beiden Songwriter, diffuse Stimmungen in griffige Textslogans und prägnante Instrumentalriffs zu packen. Und es ist die brillante Produktion, die mit sicherem Gespür die Gratwanderung meistert zwischen leuchtenden Klangfarben und rockender Bodenständigkeit. Ähnlich elektrisierend fallen die beiden Nachfolgesingles aus: „(I Can’t Get No) Satisfaction“ und „Get Off Of My Cloud“, ein wahrlich grandioses Trio, mit dem die Stones den Liverpoolern endlich auf Augenhöhe begegnen. Interessant auch die B-Seiten dieser Singles. So zelebriert „Play With Fire“ erstmals die düstere und dekadente Seite des Stones-Kosmos.
Ende ’65 und im März ’66 entsteht in Hollywood „Aftermath“, ein Album von bahnbrechender Bedeutung für die Band, denn Jagger/Richards schreiben das komplette Material selbst. Das Ergebnis kann sich hören lassen, bietet jede Menge Klassiker und mit dem über elfminütigen „Goin‘ Home“ gar die erste echte Psychedeüc Blues-Session der Rockgeschichte (auch wenn Jaggers vokale Improvisationen hier noch naiv und ein wenig linkisch wirken). Zudem erschließen sich die beiden Songschreiber auch textlich neues Terrain, die bigotte Doppelmoral der britischen Nachkriegsgesellschaft wird ebenso verhandelt wie Jaggers bevorzugtes Sujet, die Frauen, denen er sich in Songs wie „Under My Thumb“ mit unverhohlenem Machismo annimmt. „Aftermath“ wird sozusagen das „Rubber Soul“ der Stones. Diese Phase bis Ende 1966 darf getrost als erster Höhepunkt in der Bandkarriere gelten, die Truppe steht voll im Saft, gestahlt in Hunderten von Konzerten, gewohnt, schnell und präzise zu arbeiten, und noch nicht geschwächt durch Drogen, Frauen und sonstige Unbill. Brian Jones strahlt auf seinem kreativen Peak, liefert immer wieder überraschende Beiträge. So setzt er auf „Paint It Black“ eine Sitar ein und spielt das Thema von „Under My Thumb“ auf einem Marimbaphon. Außerdem brilliert er regelmäßig auf der Harp oder an der Gitarre, die ihn allerdings zunehmend langweilt.
2000 Light Years From Home (1967)
Ein katastrophales Jahr für die Gruppe, das vor allem wegen der Drogenprozesse gegen Jagger, Jones und Richards in Erinnerung bleibt. Aber auch wegen der künstlerischen, nun ja, Irritationen. Die Krise deutet sich schon auf „Between The Buttons“ an. Das Album – wir sprechen vom englischen Original, nicht der für den US-Markt umgemodelten Version – klingt mit seiner fast Vaudeville-mäßigen Atmosphäre zwar rund und geschlossen und lässt überdies erstmals den massiven geistigen Einfluss des in diesen Tagen übermächtigen Dylan erkennen. Kompositorisch jedoch bleibt es seltsam blass, und der muskulöse Bluesrock des Gespanns Watts/Wyman/Richards blitzt nur stellenweise auf. Vollends die Linie verliert die Band in den folgenden Monaten, als ihre kreativen Köpfe mehr mit Anwälten, Gerichten und nicht zuletzt internen Liebesdramen zu tun haben als allen lieb sein kann. Überdies ist das Verhältnis zu Manager Oldham völlig zerrüttet. Richards im Rückblick: „Für mich ist es immer noch ein Wunder, dass wir zu dieser Zeit überhaupt etwas zustande gebracht haben.“ Die Arbeiten an „Their Satanic Majesties Request“ werden immer wieder unterbrochen, ziehen sich fast über das ganze Jahr hin. Fatal, zumal die Stones schon damals lieber im Studio auf Eingebungen warten als dort mit fertig ausgearbeitetem Material aufzutauchen. Folglich rutschen den Glimmer Twins zwar hin und wieder Geistesblitze aus der Feder, die jedoch gehen wie „2000 Light Years From Home“ und „She’s A Rainbow“ im mediokren Gedudel fast unter.
Trotz eines gewissen psychedelischen Charmes und einiger interessanter Ideen wird „Majesties“ zum Absturz, zur einfältigen Nabelschau neureicher Rockstars, die an der von den Beatles gestellten „Sgt. Pepper“-Aufgabe scheitern. Und das noch nicht mal großartig, sondern kläglich. Dabei hätte „Majesties“ zumindest akzeptables Stückwerk werden können, hätte man auf Unausgegorenes verzichtet und stattdessen die Singles „Ruby Tuesday“/“Let’s Spend The NightTogether“und“WeLoveYou“/“Dandelion“ins Tracklisting aufgenommen. Aber der LSD-benebelte Imperativ dieses Summer Of Love verlangt nach ausgefreakter Ware.
Schwamm drüber, das Jahr geht letztlich glimpflich vorüber, „Majesties“ verkauft ordentlich, und die Drogenurteile werden sämtlich in Bewährungsstrafen umgewandelt. Die robusten Jagger und Richards verfahren ungerührt nach der Devise „Was uns nicht umhaut, macht uns nur noch stärker“, Jones indes wankt, kann dem dauerhaften Druck nicht mehr standhalten, wird zunehmend fragil und paranoid. In seinen seltener werdenden hellen Momenten liefert ernoch immer akustischen Goldstaub, interessiert sich zunehmend für exotische Musik und nimmt mit Einheimischen in Tanger ein Album auf, das als Pioniertat in Sachen Weltmusik gelten darf.
Midnight Rambler (1968-71)
Zu Beginn des Jahres 1968 herrscht Katerstimmung im Stones-Lager: Die Trennung von Oldham ist vollzogen, der Bandzusammenhalt zeigt erste Risse. Musikalisch ist das Unternehmen in eine Sackgasse geraten, seit „Paint It Black“ (’66) hat die Band keine Nr. 1-Single mehr gelandet. Da gelingt Jagger ein Glücksgriff: Für die Produktion der nächsten Single verpflichtet er Jimmy Miller. Der 24-jährige New Yorker hat zuvor mit Traffic gearbeitet. Er schafft es, die Energie der Stones zu kanalisieren, gleichzeitig den Fokus wieder auf die Blueswurzeln zu richten und mit ausgefallenen Ideen das gewisse klangliche Extra herauszukitzeln. Überdies können Jagger und Richards erstmals frei von Zeitdruck arbeiten. Das erste Produkt dieser Konstellation, „Jumping Jack Flash“, schlägt im Mai 1968 ein wie die sprichwörtliche Bombe, landet weltweit in der Poleposition und katapultiert die Stones in die nächsthöhere Pop-Stratosphäre. Vor allem aber definiert es für alle Zeiten den Stil des typischen Stones-Rockers: Richards‘ Trademarkriff, ein geifernder Jagger, eine Rhythmusgruppe, die nicht viel Federlesens macht, und eine Coda, die den Song zum Ausklang in einer Endlosschleife ins Hirn des Hörers bohrt. Diese Formel hört man hier zum ersten Mal in Reinkultur.
Jetzt sind sie nicht mehr nur die hypererfolgreichen Bad Boys des Pop, sondern die jenseits des Tagesgeschäfts thronenden finsteren Fürsten einer jungen Rockaristokratie, die zwischen Golden Gate Park und Piccadilly Circus über eine eigene subkulturelle Gegenwelt herrscht. Der Promofilm zu „Jumping Jack Flash“, in dem die Band androgyn geschminkt auftritt, nimmt zudem die erst Jahre später folgende Glamwelle vorweg. Jumping Jack Flash“ ist von mindestens so zentraler Bedeutung für die Musik der Stones wie „Satisfaction“, das sie vier Jahre zuvor vom Image der Blueskopisten befreit hatte.
Die Sessions zum nächsten Album, „Beggars Banquet“, erbringen ungeahnte Höhenflüge. Die Songs setzen sich explizit mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit der rebellischen Spätsechziger auseinander und kokettieren dabei mit Satanismus ebenso wie mit Lolita-Sex und Drogen. Richards entdeckt die famosen Möglichkeiten der vor allem im frühen Mississippi Delta Blues gebräuchlichen offenen Gitarrenstimmungen und findet als Instrumentalist seine ureigene Sprache. Watts und Wyman spielen wie aus einem Guss, nur Jones hängt apathisch in irgendeiner Ecke des Studios herum. „Beggars Banquet“, erschienen am 5. Dezember ’68, wird zum künstlerischen Triumph, vielleicht dem größten, den die Band je erlebt. Von der ekstatischen Rock’n’Roll-Samba „Sympathy For The Devil“ über den knorrigen Country-Blues „Dear Doctor“, das epische „Salt Of The Earth“, die pure Energie von „Street Fighting Man“ bis zur hypnotischen Boshaftigkeit des „Stray Cat Blues“ durchschreiten die Stones gelassen und voller Autorität ihr musikalisches Universum. Jones ist da längst im Abseits, muss nur noch elegant abserviert werden. Das geschieht am 8. Juni ’69. Einen knappen Monat später ist der Gründer der Rolling Stones tot. Und einen Tag nach seinem Ende machen die Stones mit „Honky Tonk Women“ und dem blutjungen, hoch talentierten Mick Taylor einen neuen Anfang. „Honky Tonk Women“ hält das hohe Niveau, glänzt mit Watts‘ souveränem Groove, Richards‘ Riff-Monumenten und fetten Bläsern.
Ab jetzt können sie kaum noch etwas falsch machen. Erstmals seit 1966 geht die Band im November 69 wieder auf US -Tournee, die bekanntlich am 6. Dezember mit dem Desaster von Altamont endet. Musikalisch jedoch befindet sich die Gruppe im Zenit. Auf dem in New York mitgeschnittenen „Get Yer Ya-Ya’s Out“ strotzen die Stones vor Spiellaune. Taylor ist schon erstaunlich ins Geschehen integriert, und manche der hier gespielten Songs sind den Studio-Originalen mindestens ebenbürtig.
Ein weiteres Album, „Let It Bleed“, bringt wiederum Klassiker zuhauf, darunter das perfekt die Stimmung der desillusionierten Post-Woodstock-Generation formulierende „Gimme Shelter“, das fast philosophische „You Can’t Always Get What You Want“ und den sardonischen „Midnight Rambler“. Taylor tritt auf diesem Album, das zum Teil noch vor seinem Eintritt in die Band entstanden ist, nicht wirklich in Erscheinung, die Gitarrenparts sind fast ausschließlich von Richards eingespielt. Taylor muss sich an die Arbeitsweise der Band erst gewöhnen, seine Bemerkung vom Sommer ’69 spricht da Bände: „Ich war geschockt, wie schlecht sie spielten, und fragte mich, wie sie diese unglaublichen Platten zustande gebracht hatten.“ Seine Duftmarke hinterlässt der Neue erst auf dem nächsten, wiederum als Opus magnum zu wertenden Album, „Sticky Fingers“. Das tut er allerdings gleich so eindrucksvoll, dass bis heute eine Menge Leute der Meinung sind, die Stones hätten in ihm den besten Gitarristen ihrer Geschichte gehabt.
Taylors Beitrag zum Stones-Sound: eine bislang ungekannte melodiöse Virtuosität.
Ansonsten gehört „Sticky Fingers“ vor allem wegen seines reifen Songwritings zum Besten, was die Band je veröffentlicht hat. Die nun auf die 30 zugehenden Jagger und Richards, schon damals gelten sie als Veteranen der Szene, erreichen in Songs wie „Sister Morphine“, „I Got The Blues“ und „Wild Horses“ eine neue, tiefere Dimension. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Drogen ist nicht nur textlich
von großer Präzision, sie erfährt auch musikalisch die adäquate Umsetzung, „Sister Morphine“ vermittelt mit spröder Harmonik und dramatischem Aufbau eindrucksvoll die Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit eines Süchtigen. Überdies markiert „Sticky Fingers“ den Beginn eines massiven Flirts mit der Countrymusik. Gram Parsons, seit Sommer 1968 eng mit Richards befreundet, gewinnt immer stärkeren Einfluss auf das musikalische Herz der Rollmg Stones.
Tom &Frayed (1971)
Dieses Herz heißt im Sommer ’71 unangefochten Keith Richards, und es schlägt in seinem ganz eigenen Rhythmus. Wenn Richards im Studio lächelt, ist ein Song im Kasten. Wenn nicht, dann nicht. Zu Sessions taucht er auf, wenn ihm danach ist, Uhrzeiten sind ihm wurscht. Mitunter dudelt er stundenlang ein und dasselbe Riff wie ein Mantra vor sich hin, bis sich unendlich langsam die Konturen einer Melodie oder eine Struktur aus dem langen Malstrom herausbilden. Was die anderen derweil machen, interessiert ihn nicht. Richards ist sein eigenes Metrum. Folglich ist allen klar, dass die Sessions zu „Exile On Main St.“ in Richards‘ Haus in Villefranche-surmer stattfinden werden, nachdem die Band aus steuerlichen Gründen im Frühling 1971 komplett nach Südfrankreich übergesiedelt ist und sich dort kein passendes Studio finden lässt. Keith kommt die Situation entgegen: Er kann arbeiten, wann immer er Lust hat. Und so wird „Exile On Main St.“, mehr als jedes andere Stones-Album, seine Platte.
Heute gilt „Exile“ nicht nur in Fachkreisen als absoluter Höhepunkt im Stones-Katalog, und das, obwohl das Album kaum Hits abwarf – die Singles „Tumbling Dice“ und „Happy“ rissen nicht wirklich viel und die Verkaufszahlen relativ dürftig ausfielen. Bei Erscheinen des Albums ist das mitnichten so, die Kritik zerreißt das Werk. So zetert der Rezensent in SOUNDS vom August ’72: „Fast wäre es zu wünschen, dass sie sich zur Ruhe setzten, denn dieses Werk ist eine Katastrophe, gegen die selbst das weiße Doppelalbum der Beatles verblasst.“ Noch Fragen?
Das harsche Urteil ist schnell erklärt: „Exile“ kann kaum mit spektakulären Songs vom Schlage „Brown Sugar“ oder „Sympathy ForThe Devil“ aufwarten. Die ungeheure Kraft des damals als Doppel-LP erschienenen Albums liegt vielmehr in seiner Haltung, der so hedonistischen wie dekadenten Attitüde und der großartigen Musik, die alle Ecken und Winkel der Blues- und Country-orientierten Rockmusik kompetent und hingebungsvoll ausleuchtet. Zwar gibt es auch auf „Exile“ markantes Material, etwa dengTandiosen Gospelrock von „Tumbling Dice“ und „Let It Loose“, den entspannten Folk-Schunkler „Sweet Virginia“ den geradezu majestätisch fließenden Countryrock von „Torn & Frayed“ oder Richards‘ RifF-Rocker „Happy“. Nur ist all dies spartanisch designt. Das Klangbild des Albums ist naturbelassen, es gibt kaum exotische Instrumente oder auffällige Klangeffekte. Klavier, Gitarre und Bläser klingen wie Klavier, Gitarre und Bläser. Mellotron, Sitar oder sonstiger Tand: Fehlanzeige. Richards und Taylor verweben ihre Gitarren so virtuos und filigran, wie es die Band zuletzt in den frühen Bluestagen praktizierte. Charlie Watts hat sich zum vielseitigen Mannschaftsspieler mit ureigener Handschrift entwickelt. Und Mick Jagger demonstriert neben gesanglicher Reife einmal mehr sein Harp-Talent. Garniert wird der kernige Bandsound von Bobby Keys und Jim Price, die jede Menge Bläsersätze beisteuern. Purer, rauer Stoff, mit dem sich viele Stones-Fans zunächst schwer tun.
Auch vollzieht sich ab 1970, spätestens spürbar auf „Exile“, ein tiefgreifender Wandel in der Songwriter-Partnerschaft Jagger/Richards. Beide sind im Sommer ’71 nicht mehr die Blues-besessenen Teenageraus Dartford, sondern weltläufige, hofierte Rockstars, erwachsene Männer, die ihr eigenes Leben fuhren und in festen Partnerschaften leben. Jeder hat sich sein privates Umfeld geschaffen, und jeder hat inzwischen seine spezifischen Interessen ausgebildet. Folglich entstehen ihre Songs immer öfter ohne den anderen, es gibt nur selten noch tatsächlich gemeinsam Geschriebenes. Jagger/Richards-Songs werden in Zukunft verstärkt die jeweilige Handschrift ihres Urhebers offenbaren.
Für die Stones als Band markiert „Exile“ überdies einen entscheidenden Schritt: Sie sind nun keine englische Band mehr. Man agiert international, das Zentrum der Aktivitäten ist nur noch bedingt London, die USA werden immer wichtiger, gerade auch im Hinblick auf die immer monströser werdenden Konzerttourneen. Die legendäre US-Tour vom Sommer ’72 wird zur Ur-Mutter aller Sex & Drugs & Rock’n’Roll-Märchen. Die Verwurzelung der Stones in der Londoner Szene, auch ihr sozialer Background (für Songwriter wie etwa Ray Davies lebenswichtig) tritt in den Hintergrund, stattdessen sind alle fünf Stones jetzt Teil des internationalen Jetset.
It’s Only Rock’n’Roll (1973-77) „Goats Head Soup“ entsteht 1973 auf Jamaika. Mick Jagger bemüht sich, wie er dem Journalisten Chris Welch erzählt, „eine größere Bandbreite in den Songs und der Art, wie sie gespielt werden “ sicherzustellen. Genau da liegt der Hase im Pfeffer, das Ganze wirkt zerrissen und gestückelt. Neben Gelungenem („Coming Down Again“, „Star Star“ und dem Kuschelrock „Angie“) steht ein unausgegorener Weltmusik-Versuch („Can You HearThe Music“) sowie Überflüssiges („Hide Your Love“). Und ausgerechnet in ihrer Paradedisziplin, dem straighten Rock, klingt die Band trotz aufwändiger Produktion seltsam blutleer.
Anders „It’s Only Rock’n’Roll“, aufgenommen 1974 in den Münchener Musicland Studios. Hier spielt die Gruppe wieder wie aus einem Guss. Und das Titelstück liefert gleich den Slogan für ein ganzes Jahrzehnt (und den kompletten Bandkatalog dazu). Aber: Obwohl das Album gediegenes Handwerk bietet und durchaus seine Momente hat, wirkt es oberflächlich, mangelt es an Substanz und Charakter. Die Position des reinen Entertainments, die es vertritt, scheint Jaggers Credo geworden zu sein. Und Richards versinkt immer tiefer im Heroinsumpf. Taylor zieht die Notbremse, hat Angst vor einem ähnlichen Suchtproblem und träumt von neuen musikalischen Horizonten – im Dezember ’74 steigt er aus, sehr zur Überraschung seiner zunächst verdutzten Brötchengeber.
Die jedoch suchen genauso ungerührt wie nach Jones‘ Abgang Ersatz. „Black And Blue“ (1976) dokumentiert diese Suche. Von den vielen Kandidaten, die man bei ausgiebigen Auditions testet, schaffen es drei auf die Platte:
Harvey Mandel, Wayne Perkins und Ronnie Wood. Letzteren, der schließlich den Zuschlag erhält, halten viele für die schlechteste Wahl. Aber Woody gehört zu Keiths engsten Freunden. Und er profiliert sich schnell als ausgleichendes Element zwischen Jagger und Richards. Musikalisch fällt „Black And Blue“ in die Abteilung „Selbstfindung“ – mit der Konsequenz des gelegentlichen Scheiterns. „Hot Stuff“ übt den discotauglichen Street-Funk, „Cherry Oh Baby“ ist ein erster (misslungener) Ausflug ins Reggae-Fach, „Melody“ eine feine Übung in Bar-Jazz und „Fool To Cry“ nicht nur für Stones-Verhältnisse reichlich überzuckert.
Seit „It’s Only Rock’n’Roll“ produzieren sich die Glimmer Twins selbst. Der ausgelaugte und mittlerweile seinerseits mit einem Drogenproblem kämpfende Jimmy Miller wird nach „Goats Head Soup“ ausgemustert. Musikalisch hat die Band ihre Möglichkeiten nunmehr erschlossen, zum patentierten Open-G-Tuning-Rock mit Blues-und Soulgrundierung gesellen sich gelegentliche Abstecher ins Country-, Reggae- oder Balladen-Fach. Wesentliches werden sie dieser Palette nicht mehr zufügen.
Respectable (1978-82)
Weiß Gott, respektiert sind sie nach 20 Jahren on top. Aber nicht unverwundbar. Als Richards 1977 in Toronto mit reichlich Heroin verhaftet wird und um ein Haar für mehrere Jahre hinter Gitter muss, versteht der Gitarrist die Zeichen an der Wand. Er schafft den Entzug. Den klaren Kopf kann er gebrauchen, denn der Punk rüttelt zornig an den Fundamenten der etablierten Rock Society, und zu den schlimmsten Feinbildern der No-Future-Generation gehören unsere in die Jahre gekommenen Helden. Ihre Antwort, „Some Girls“, allerdings ist trocken, hart und ein letztes Mal restlos überzeugend. Lediglich am tanzbaren und vermeintlich modischen Singlehit „Miss You“ scheiden sich die Geister. Der Rest der Platte indes rockt kompakt, zeigt Rotten 8t Co. den Stinkefinger und schlägt die Drei-Akkord-Wunder aus dem Londoner „100 Club“ mit deren eigenen Mittem. Die Stones besinnen sich ihrer Blues- und Soulwurzeln, klingen plötzlich rau und rotzig wie lange nicht. Noch einmal schlägt das Imperium zurück, ab 1980 aber lehnt es sich behaglich in die Polster. „Emotional Rescue“ entstanden im Urlaubsparadies der Bahamas, wird zum Absturz. Viel schwerer als die schwachen Songs wiegt dabei: Den Stones scheint die Fähigkeit abhanden gekommen zu sein, seismographisch zuverlässig die Zeitläufte zu registrieren und in ihren Songs aktuelle Strömungen und Entwicklungen zu reflektieren. „Emotional Rescue“ hat kaum eine Bindung zur Welt da draußen. Es wird das erste unwichtige, überflüssige, streckenweise selbstgefällige Stones-Album.
Eine alarmierende Tendenz, die „Tattoo You“ allerdings noch einmal kaschieren kann. Allein der Opener „Start Me Up“ ist das Album wert. Ein Kritiker attestiert im Vergleich zur Konkurrenz von E.L.O. bis Dire Straits „musikalische Höhlenmalerei“ und trifft den Nagel auf den Kopf. „Start Me Up“ wirkt wie ein reinigendes Gewitter: ein Riff wie die Eigernordwand, ein Jagger, der klingt wie gerade 24, und eine Produktion, die gekonnt die Brücke von Chess zur Mehrspur-Moderne schlägt. Der Rest des Albums immerhin enttäuscht nicht und hält mit „Worried About You“ sowie dem rührenden .^Vaiting On A Friend“ gar zwei feine Balladen bereit. Allerdings: „Tattoo You“ besteht größtenteils aus Restbeständen älterer Sessions, die Evolution etwa von „Start Me Up reicht zurück bis 1977.
Die anschließende Welttournee 1981/82 geht als erste echte Stadion-Tour in die Rockgeschichte ein. Und die Presse feiert die Veteranen sowie den Umstand, dass die neben neuen hauptsächlich alte Hits präsentieren – fortan sind Rolling Stones-Tourneen in erster Linie „Greatest Hits“-Revuen für die ganze Familie. Der Mythos feiert sich selbst und das Publikum die eigene Vergangenheit, die 60er Jahre sind nur noch Erinnerung, „eine Montage aus Hotels, Flugzeugen, schäbigen Konzerthallen und dem Geruch von Bier undfeuchten Mädchenslips nach der Show“, wie R ichards gewohnt blumig formuliert.
Fight (1983-88)
Viel hat nicht gefehlt, und die Band hätte in den unseligen Achtzigern das Zeitliche gesegnet. Aber zum Ende des Jahrzehnts legen Jagger und Richards ihren jahrelangen Zwist bei. Was war passiert? Nach dem zwar erfolgreichen, aber letztlich in müder Selbstreferenz und behäbiger Rockerpose verharrenden „Undercover“, zu dem Jagger mit „Undercover Of The Night“ noch den couragiertesten Track beisteuert, entschließt sich der Sänger, sein erstes Soloalbum zu produzieren. Und, in den Augen von Partner Richards, schlimmer noch, damit auf Tour zu gehen. Als Jagger dann auch noch live Stones-Hits zum Besten gibt, platzt Richards der Kragen. Die Glimmer Twins beschimpfen sich öffentlich wie alte Waschweiber. Das mit Mühe fertig gestellte Album „Dirty Work“ wird dadurch nicht besser. Die erste Single, „Harlem Shuffle“, ist bezeichnenderweise eine, wenn auch gelungene, Coverversion eines alten R’n’B-Hits aus den Sechzigern. Trotzdem ist nicht zu überhören: Dem Album mangelt es an plausiblen Ideen. Die Stones wirken ausgebrannt, scheinen drauf und dran, sich selbst zu demontieren. Wie wenig Jagger in jenen Tagen am eigenen Mythos liegt, hat Toningenieur Dave Jerden dem amerikanischen Journalisten Steve Appleford erzählt: Um für den Whoopie-Goldberg-Film „Jumping Jack Flash“ (’86) den Stones-Hit gleichen Titels mit neuem Leadgesang aufzumöbeln, brachte Jagger das Mastertape mit ins Studio und besang die originale (!) Gesangsspur neu. Wer immer also den Song mal remastern möchte – zu spät.
Continental Drift 1989-95
Zeitgleich mit der großen Wende im Weltgeschehen auch die Wende im Stones-Lager: Versöhnung, Friede, Freude, Eierkuchen, gemeinsamer Urlaub der Herren Jagger und Richards auf Barbados und – hokus pokus – mit „Steel Wheels“ ein nagelneues Studioalbum, plus Welttournee mit inzwischen üblichem Giganto-Brimborium. Die Steine rollen ins neue Jahrzehnt, erstaunlich vital, fast juvenil. Trotzdem sind die zwölf Songs kaum mehr als routinierte Inszenierung des eigenen Mythos. Die Zutaten sind vorhersehbar wie eh: hier ein paar knackige Memphis-Bläser, dort eine romantische spanische Gitarre, beizeiten rauhes Riff-Gewitter, eine Prise Ethno-Geklimper, ein bisschen Macho, ein bisschen Dirty-Old-Men-Sentiment. So weit ist daran nichts auszusetzen. Und es gibt schlechtere Alben der Band, aber letztlich ist auch „Steel Wheels“ nicht mehr als ein, wenn auch anständiger, Existenznachweis.
1992 stehen die Stones plötzlich ohne Bassisten da, Wyman geht nach 30 Jahren in Rente. Wirklich wichtig ist der Abgang allerdings nicht – Cobain ist längst der neue Jagger, Techno und Hip-Hop dominieren den Pop, und Chuck Berry kennt eh kein Mensch mehr. Charlie Watts selbst nimmt die Sache in die Hand und entscheidet sich für den Besten, der sich um den lukrativen Posten bemüht: Darryl Jones, vormals bei Miles Davis. Manch einer fragt sich, was diese Altrocker-Kapelle wohl von einem Jazzvirtuosen wie Jones will, dabei ist die Antwort ganz simpel: sauberes Handwerk – symptomatisch für die Rolling Stones der 90er Jahre. Die gute alte Zunge steht nicht mehr für Anti-Establishment, sondern für perfektes Rock-Entertainment. „Voodoo Lounge“, das I994er-Abum, könnte folgerichtig genauso gut heißen: „Mick, Keith &. Charlie feat. Ronnie Wood play The Rolling Stones“. 15 Songs lang ergeht sich der verwitterte Vierer in Selbstzitaten, alles schon mal gehört, alles schon mal gesagt, alles schon mal gesehen.
Wesentlich interessanter ist da schon „Stripped“ (’95). Neben einigen Mitschnitten von Clubgigs präsentiert das Album bei Rehearsals entstandene Unplugged-Aufnahmen diverser Klassiker. Und da kommt etwas rüber, was bei den Stones lange nicht zu spüren war: die pure Lust am Musizieren.
HowCan I Stop (1997-?] Nach der „Voodoo Lounge“-Tourgeht die Band unter prallen Segeln gleich wieder ins Studio. „Bridges To Babylon“ erscheint 1997, und es offenbart schonungslos das beinahe unentrinnbare Dilemma, in dem die Rolling Stones inzwischen stecken: Zwar gelingen ihnen immer noch hin und wieder tolle Songs. Aber: An jeder Note, die Jagger singt, jedem Akkord, den Richards und Wood spielen, und an jedem Beat, den Charlie auf sein antiquarisches Gretsch-Set hämmert, hängen 40 Jahre Rockgeschichte, 40 lange, turbulente, glorreiche Jahre Rolling Stones. Ein Mythos, der in den Köpfen des Publikums tausendmal schwerer wiegt als in denen seiner Urheber. Jeder neue Song hat im großen Katalog der Band seinen Vorläufer und wird automatisch an „Satisfaction“ oder „Start Me Up“ gemessen. Das Lied, das all diese Glanztaten zumindest für den Moment in den Hintergrund drängen könnte, werden auch Jagger/Richards in diesem Leben nicht mehr schreiben. Also fragen sich viele, zuvorderst natürlich die Kritik: Was soll das, wer braucht das noch?
Den Stones selbst wird das herzlich egal sein. Richards, der sich im Alter gelegentlich eine sentimentale Countryballade gönnt, die er mit rührender Emphase ins Mikro krächzt, betont seit Jahren, dass er herausfinden will, wie weit ihn das Abenteuer Rolling Stones noch bringen wird. Also wird der alte Herr auch mit 70 noch im Leopardenmantel mit Sonnenbrille und künstlich gealterter Telecaster auf irgendeiner Bühne stehen – wenn der große Chef da oben ihn lässt. So einen Axt“Muddy Waters in the making“, wie ihn ein Musiker einst nannte. Künstlerisch ist eh längst alles gesagt. Und Jagger? Respektabel ist die athletische Leistung, die der Mann auch mit fast 60 noch bringt, allemal. Ansonsten scheint er bis in alle Ewigkeit den Pop-Parvenue geben zu wollen, wobei ihn zuvorderst das Erobern knospender „Little T&A“-Sternchen umtreibt. Wood wird eines Tages das letzte Glas Wodka getrunken haben und breit grinsend im Himmel die Theke suchen. Und Charlie hat es irgendwie geschafft, das Ganze in Würde zu überstehen. Vielleicht wusste er immer, dass es nur Rock’n’Roll ist, dass er’s eh ganz gut getroffen hat und dass man’s nicht so ernst nehmen sollte.
Und doch: Die Rolling Stones haben einen Haufen großer Musik geschaffen, gleich mehrere Pop-Generationen nachhaltig geprägt und nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie, und damit die Rockmusik, ihre schiere Existenz den damals längst vergessenen schwarzen Musikern schulden. Ganz nebenbei haben sie entscheidend mitgeholfen, aus einer anfangs belächelten Mode eine echte Kunstform und eine milliardenträchtige Industrie gleichermaßen zu entwickeln. Steinreich sind sie dabei auch noch geworden – nicht schlecht für eine Handvoll bluesverriickter Teenager aus einem Londoner Vorort.