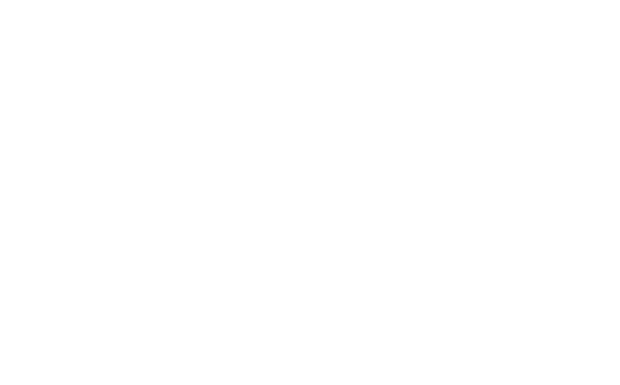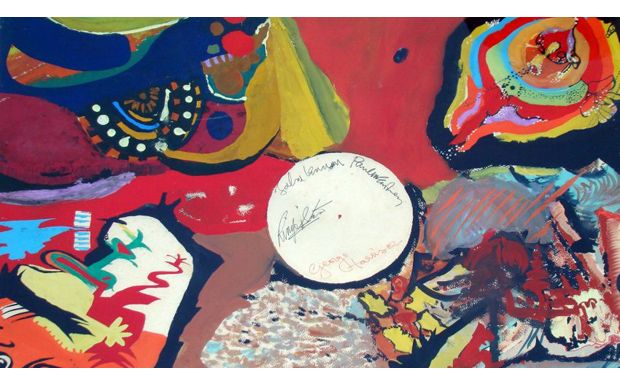Here comes the son
Es gibt Leute, mit denen man nie und nimmer tauschen möchte. Julian Lennon ist so einer. Geboren in Liverpool zwischen „Please Please Me“ und „From Me To You“, Sohn von Beatie John und der-Frau-die-nicht-Yoko-war, verfolgt von dubiosen Hellsehern, die ihm einreden wollen, sein Daddy selig schreibe da droben im Himmel für ihn laufend Hits -— und einzig und allein sie könnten die übernatürliche Jam-Session zwischen Vater und Sohn vermitteln. Doch Sohnemann himself schreibt nicht die übelsten Songs für einen blutigen Anfänger —- wenn auch seine Texte nicht mit dem scharfzüngigen Sarkasmus seines alten Herrn glänzen können, der immerhin und nicht zu vergessen John Lennon, der sagenumwobene Beatie, war!
Man läßt uns die Beatles einfach nicht vergessen. Die Fab Four sind allgegenwärtig: im Radio, bei Quiz-Sendungen — und für die oberen 10.000 gibt’s als Schmankerl auch hie und da ein paar Beatles-Antiquitäten bei Sotheby’s. Wie also könnte Julian diesem übermächtigen Schatten entgehen?
Wenn er nun also in dessen Fußstapfen tritt. „Erbe“. „Legende“ und Familientradition fortführen möchte — und hier geht’s ja nicht um ein Beerdigungsinstitut oder ’nen Metzgerladen! -, dann wird das in seinem Fall kaum unter Ausschluß der Öffentlichkeit ablaufen.
Ich möchte nicht Julian Lennon sein. Viele Leute verübeln es ihm, daß er nicht der Vater ist. Andere wieder vergöttern ihn nur deshalb, weil er der Sohn seines Vaters ist. Ich persönlich jedenfalls glaube, daß John -— wenn er nicht durch seine letzten Jahre als Hausmann völlig meschugge wurde —- Julians Musik weit besser gefallen hätte als Yokos schrilles Star Peace-Gezwitscher.
Julian ist 23, mit einer kessen Rocksängerin namens Fiona verbandelt, sagt, er verbringe seine Freizeit mit Faulenzen und mache das alles nur für den schnöden Mammon.
Was ist das größte Mißverständnis, das über dich in Umlauf ist? Erste Frage an Julian, der mir im Büro seiner Plattenfirma gegenübersitzt und fast versinkt in seinem riesigen, grellbunten Jackett.
„Die meisten Leute hallen mich für stinkreich“, antwortet er in dezentem Liverpool-Englisch, „und obendrein für ein arrogantes Bürschchen, dem sowieso alles völlig schnurz ist. Dabei bin ich das genaue Gegenteil.“
Nicht ganz. Er ist reich.
„Eben nicht! Ich kann über mein Erbteil erst mit Ende 20 oder gar 30 verfügen. Ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt selbst. Wenn ich die dicke Mark gehabt hätte, wäre ich jetzt sicher nicht im Musikgeschäft.
Versteh‘ mich nicht falsch: Ich bin Musiker, weil’s mir Spaß macht, aber wenn ich schon immer in der Knete geschwommen wäre, hätte ich sie wahrscheinlich mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen. So aber weiß ich den Wen des Geldes zu schätzen. Wenn du dir zum Beispiel von deinem sauer verdienten Geld eine Couch kaufst — und jemand schüttet dir aus Dämlichkeit drüber, dann denkst du: .Scheiße! Mann, dafür hab‘ ich hart gearbeitet!“‚ Er lacht. Ich gelobe innerlich, höllisch aufzupassen, keine Zigarettenasche auf sein Jackett zu schnippen.
Soviel zum Verhältnis zu materiellen Werten. Was bedeuten ihm politische? Fühlt er sich durch John und Yokos politische Botschaft verpflichtet, weiter das Lennonsche Banner zu schwenken?
„Ja … natürlich habe ich auch so meine Vorstellungen vom Leben, Politik, Krieg etc.“ Die Frage scheint ihm ein wenig unangenehm zu sein.
„Ich habe auch Songs in der Richtung geschrieben. Aber das ist zu einfach, zu naheliegend. Denn genau das wird natürlich von mir erwartet. Vielleicht werde ich in ein paar Jahren als eigenständiger Musiker akzeptiert; dann kann ich mich auch dieser Thematik stärker zuwenden. Im Moment hab‘ ich sowieso noch nicht den optimalen Durchblick, um Gott und der Welt meine Meinung darüber aufzudrängen, was gut oder schlecht ist. „
Mangelnde Erfahrung hat seinen Vater aber nie von irgend etwas abgehalten. Natürlich kann ich mir diesen Gedanken nicht verkneifen. Wie verhält man sich in den Flegeljahren, wenn der Vater der Prototyp des Rebellen war? Wo und wie kann man da noch anecken?
„Mein erster Stiefvater war ein netter, witziger Italiener -— ein verrückter Typ, der immer was losmachte. Alles lief locker und easy, nicht gerade zu frei, aber akzeptabel. Mein zweiter Stiefvater dagegen übertrieb die Vaterrolle. „Um 10 bist du wieder zu Hause!'“, äfft ihn Julian nach und haut auf den Tisch. „Aber ich dachte mir nur ‚Leck mich doch!‘ und verschwand tagelang. Meine Mutier ist schier verzweifelt. Aber ich konnte nicht mit diesem Typ leben, er ist nicht mein Vater, er hatte kein Recht dazu!“
Seine Mutter jedenfalls spornte ihn nicht gerade an, als er seine erste Rockband gründete (mit Schulfreund Justin Clayton, der auch heute noch mit von der Partie ist), was aber nicht weiter überrascht, wenn man sich vor Augen hält, daß Cynthia Lennon von ihrer Verbindung mit dem Rockgeschäft nie allzuviel Kapital schlagen konnte.
„Sie konnte mich natürlich nicht bremsen“, grinst Julian. „Sie wollten, daß ich weiter auf die Schule gehe, aber die Musik nahm mich so gefangen, daß mir alles wurscht war. ich hing nur mit Typen zusammen, die in Bands spielten. Als meiner Mutter nach einer Weile dämmerte, daß sie dagegen absolut machtlos war, lenkte sie schließlich ein. „
Um nochmals auf die stimmliche Ähnlichkeit zurückzukommen: „Ich singe nicht absichtlich so, ich bin doch kein Stimmenimitator! Es kommt einfach so raus, wenn ich den Mund aufmache, ganz von selbst!“
Er sagt, seine Stimme sei nach den Monaten on the road in den Staaten besser und stabiler geworden. Davon kann man sich bei seiner ersten Europa-Tournee in den nächsten Wochen überzeugen — bei der er auch sein zweites Album THE SECRET VALUE OF DAYDREAMING vorstellen wird, das er selbst als „moderner“ bezeichnet.
„Ich wollte ein bißchen stärkere Akzente auf elektronische Sounds setzen, weil das letzte Album so akusükbetom war. Als ich mit diesen wirklich beinharten amerikanischen Musikern in den Staaten spielte, klang meine Musik fast wie Heavy Metal! Und da dacht‘ ich mir: Yeah, dieser Groove hat was, also hab‘ ich ihn in das neue Album integriert. Aber eins ist gleichgeblieben: die Texte und ihre Aufrichtigkeit. „