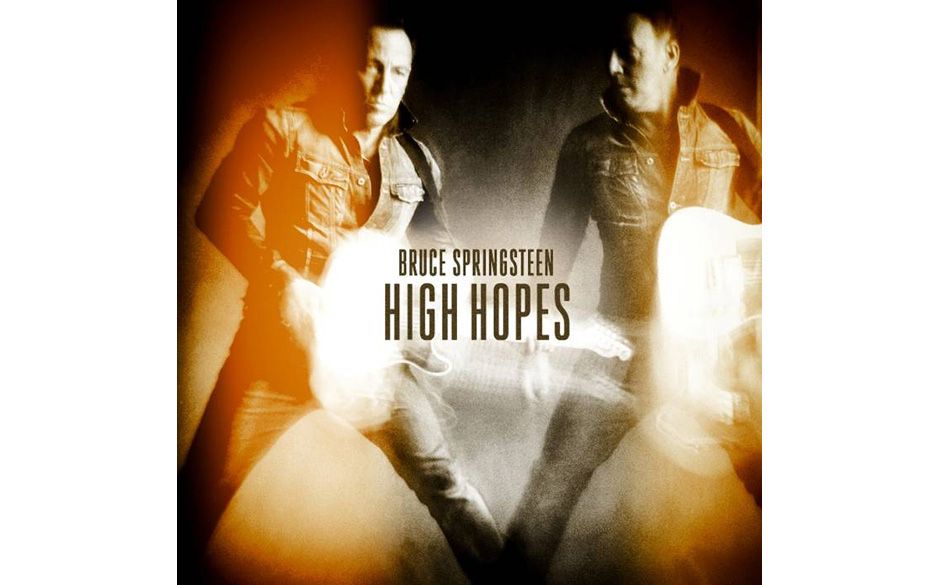Bruce Springsteen :: The Ghost Of Tom Joad
Bruce is back, und er ist nicht mehr der alte. Weiten trennen THE GHOST OF TOM JOAD von den Highway-Hymnen auf BORN TO RUN, von den Apokalypse-Allegorien auf DARKNESS ON THE EDGE OF TOWN oder gar den Top-Ten-Trivialitäten auf BORN IN THE USA. Selbst die beim ersten Hinhören naheliegenden Vergleiche mit NEBRASKA halten einem mehrfachen Hörtest nicht stand. Damals -1982 – war Springsteen der Superstar, der sich ein Soloalbum zum Atemholen gönnte. Heute steht der Mann, der nie der Boss sein wollte, längst über solchen Kategorien und ist auf dem besten Weg, der Clint Eastwood des Rock zu werden. Spröde klingt sein neues Album, lakonisch sein Gesang, karg die Instrumentierung. Mitunter wischen Baß und Drums im Hintergrund, heult aus weiter Ferne die Pedal Steel, seltener klagt eine Fiedel knapp an der Hörgrenze. Ansonsten führen Springsteens Stimme und sein schlichtes Spiel auf akustischer Gitarre und Mundharmonika durch zwölf Songs, deren archaische Schönheit sich erst nach mehrmaligem Hören erschließt. Dann aber hat einen der Zauber dieser düsteren GHOST-Stories, in denen der Künstler die Schattenseiten des amerikanischen Traums ausleuchtet, unweigerlich gepackt. Der Tom Joad, den Bruce im Titel der CD und im ersten Song beschwört, ist sein (literarischer) Bruder im Geiste, die Titelfigur aus John Steinbecks wunderbarem Roman ‚Früchte des Zorns‘ und der Prototyp vieler Figuren, die die neuen Springsteen-Songs bevölkern. Der ehemalige Strafgefangene, der auch nach Jahren nicht ins Leben zurückgefunden hat (‚Straight Time‘), der kleine Dealer, der im Rinnstein endet (‚Baiboa Park‘), der alte Tramp, der seit der Zeit der Großen Depression unterwegs ist (‚The New Timer‘), der illegale Einwanderer, rechtlos in einer fremden Welt (‚Sinaloa Cowboys‘): Sie alle jagen auf THE GHOST OF TOM JOAD dem Traum von der unbegrenzten Freiheit vergeblich nach. Anders als auf den „Familien-Alben“ HUMAN TOUCH und LUCKY TOWN gibt Springsteen auf seinem neuen Album amerikanischen Underdogs eine Stimme. Dabei ist er kein Dichter wie Dylan, kein Mystiker wie Johnny Cash, eher eine Art Tagebuchschreiber. Seine Alltagshelden haben Dreck unter den Fingernägeln, vom Wind zerzaustes Haar, tragen Overalls und sprechen eine einfache Sprache. Darin ähnelt der Sänger und Songschreiber John Steinbeck. Die Schilderungen mögen nüchtern und sachlich wirken, sind aber stets mitfühlend und voller Sympathie für die „lonesome losers“. Gänsehautmomente hat’s denn auch zuhauf auf diesem außergewöhnlichen Album. Bei Zeilen wie „Well the piss yellow sun comes bringin‘ up the day. She said ain’t nobody gonna give nobody what they really need anyway“ stehen die Härchen am Arm auf zum Salut. Wer dem „alten Boss“ nachtrauert, hat mit Joe Grushecky mittlerweile eine prima Alternative. Neugierige aber, die etwas Geduld mitbringen und auch beim zehnten Hören noch etwas entdecken wollen, sollten dem Geschichtenerzähler Springsteen folgen in die Dunkelheit am Rande der Stadt, zumindest für die 50 Minuten dieses leisen, weisen (Alters-?)Werks.
Mehr News und Stories