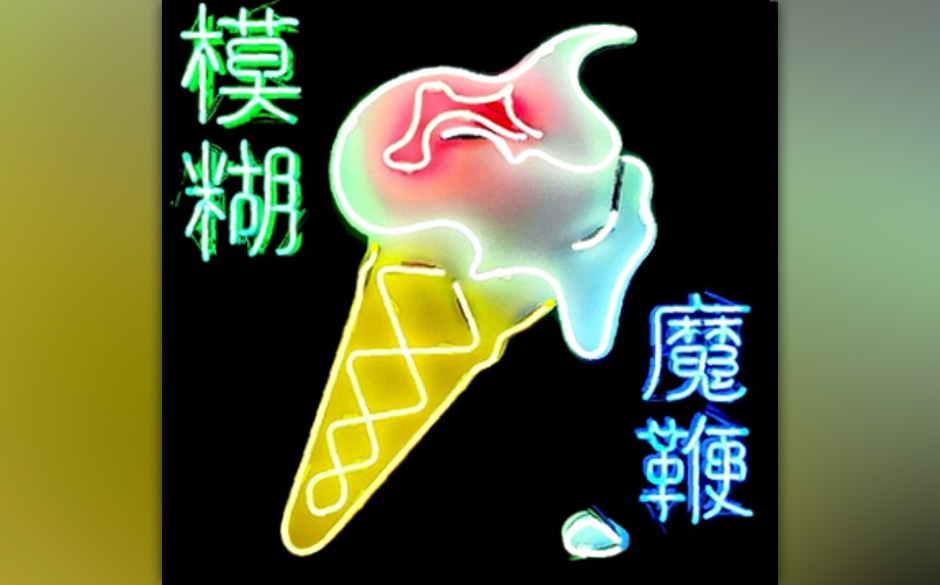L7
L7
Irgendwann kommt ja sowieso die Zeit, wo du dich entscheiden mußt, ob du dein weiteres Leben mit Frauen teilen willst, die wissen, welchen Wein man zu Perlhuhnbrüstchen in Estragonsauce trinkt, oder ob du mit Weibsgestalten zusammen sein willst, die dir in die Suppe rotzen, weil sie schlecht geschlafen haben. Und weil das alles letztlich sowieso keine Frage ist, sind Rock’n’Roll-Women nach wie vor gefragte Vertreterinnen der allgemein obwaltenden Menschlichkeit: Hauptsache fies. L7 haben zu Beginn der 90er – ungefähr genauso wie die anderen „monster girls“ von Babes in Toyland, Lunachicks oder Hole – diese Rolle perfekt ausgefüllt: immer ran, erst mal um sich treten und dann weiter so. Und daß jetzt die Rock-Attitüde der Mädels allmählich unmodern geworden ist, ist nicht wirklich ihr Fehler. Und trotzdem: L 7, das neue Produkt, klingt wie der Versuch, ein Album zu machen, das vorsichtig alle möglichen Schattierungen des Gitarrenrocks dokumentieren will: ein bißchen Punk-Sado-Gebolze, ein wenig Grunge-Maso-Renitenz und ziemlich viel relativ fein arrangiertes, ernsthaftes Handwerk ä la Patti Smith. Die Combo klingt auf dem neuen Album tatsächlich so, als würde sie gern Bands covern, die ihrerseits Stücke abgekupfert haben, die L 7 bisher zwar nicht gespielt, aber immer schon in der Schublade hatten. So kompliziert ist das. Und weil das so ist, klingen die Songs allesamt sonderbar bemüht; als ob die Mädels eine Heidenangst davor hätten, irgendeinen entscheidenden Fehler zu begehen und sich eine Blöße zu geben. Insofern dokumentiert dieses Album eine ernsthafte Verunsicherung: Weiter so geht nicht mehr.