Das sind die 100 besten Live-Alben aller Zeiten
Die 100 besten Live-Alben in der ultimativen ME-Liste – diese Platten sind für die Ewigkeit.
10. Die Ärzte – NACH UNS DIE SINTFLUT

Geschichtsträchtig ist hier allein schon der Umfang: Drei LPs und eine Bonus-Single. NACH UNS DIE SINTFLUT gelingt kurz vor dem Mauerfall das bis heute einmalige Kunststück, als Triple-LP Platz eins der Charts zu besetzen. Doch wie hätte diese Machtdemonstration Ärzte-hafter Spielfreude und Humor jenen auch verfehlen sollen, ging mit dieser Live-Veröffentlichung doch auch die Ankündigung ihrer Auflösung einher. Die Ärzte schafften sich selbst ab im Augenblick ihres größten Erfolgs. Dass es in den 90ern wieder losgehen würde, ahnte damals niemand. So brettert die Platte (damals noch mit Hagen Liebing am Bass) durch unzählige Hits und liefert mit einer Plattenseite, die lediglich aus Ansagen besteht, einen Eindruck, wie viel Comedy ein Ärzte-Konzert beinhaltet. – Linus Volkmann
Der Moment: wenn auf der Bonus-Single „Geschwisterliebe“ als Instrumental gespielt wird und das Publikum einsetzt, um den indizierten Text zu singen – und das Stück so der Zensur entreißt.
9. Bruce Springsteen & The E Street Band – LIVE/1975-85

Zwischen 1975 und 1985 ist Springsteen wahrscheinlich der großartigste Live-Künstler der Welt. Besonders die Tour zu DARKNESS ON THE EDGE OF TOWN ist ein Triumph. Ekstatische Konzerte über mehr als drei Stunden, der Songwriter als verzweifelt-romantischer Hohepriester des Rock’n’Roll. Als Getriebener, für den es um alles geht, immer. Dazu die glorreiche E Street Band, Clarence „Big Man“ Clemons, Miami Steve. Dennoch: Ein Live-Album gibt es bis Mitte der 80er nicht. Als gelte es, das wiedergutzumachen, erscheint 1986 dieses allumfassende 5-LP-Set mit Aufnahmen aus den zehn Jahren davor. Eine Werkschau zugleich, 40 Songs insgesamt. Allein die oft minutenlangen Ansagen, die Springsteen zwischen den Stücken macht, haben unter Fans längst Kultstatus. – David Numberger
Der Moment: Man könnte viel herausgreifen. Aber wenn Springsteen vom Verhältnis zu seinem Vater und von Vietnam erzählt und dann die Mundharmonika zu „The River“ einsetzt, das ist selbst hier überragend.
8. MC5 – KICK OUT THE JAMS

Auf die Frage „Süßes oder Saures?“ haben MC5 eine eigene Antwort parat: Die Band zieht zur Devil’s Night und an Halloween nicht etwa um die Häuser, sondern in den Grande Ballroom zu Detroit, um sich zwei Nächte lang durch ihr Set zu wüten. Die Falsett-Großtat „Ramblin’ Rose“ und „Rocket Reducer No. 62 (Rama Lama Fa Fa Fa)“, zwei der Höhepunkte, über allem strahlt das universell-aufwühlende „Kick Out The Jams“. Auch wenn Kritikerpapst Lester Bangs es später abwatscht, die Idee von Labelboss Jac Holzman und Produzent Bruce Botnick sollte sich als dekadenüberdauernd genial erweisen: MC5 rollen live diverse Umdrehungen heftiger als im Studio. Rau wie die Stooges, groovy wie Motown, die Ursuppe von Grunge und Punk und Grebo. – Ingo Scheel
Der Moment: das oft zitierte Spoken-Word-Intro, der universelle Ruf zu den Waffen, in seinem Klang so ansteckend, dass es fast egal ist, ob nun „Motherfucker“ die Jams rauskicken sollen oder – wie in der zensierten Jugendfrei-Version – die „Brothers & Sisters“.
7. Aretha Franklin – ARETHA LIVE AT FILLMORE WEST

„Ich verspreche euch, wenn ihr heute heimgeht, habt ihr bei dieser Show mindestens so viel Spaß gehabt wie bei jeder anderen, die ihr bisher gesehen habt.“ Spricht Aretha Franklin und startet in ein Set, das, was Energie, Spielfreude und Talent zur Improvisation betrifft, tatsächlich unschlagbar ist. Am Anfang Coverversionen: Durch „Respect“ geht’s mit doppelter Geschwindigkeit, „Bridge Over Troubled Water“ wird zum Gospel, „Eleanor Rigby“ zu Uptempo-Soul-Funk. Auf Seite zwei eigene Songs, zum Schluss wieder ein Cover: „Reach Out And Touch (Somebody’s Hand)“ von Diana Ross. Aber ob eigenes oder fremdes Material, war nie so egal: Hier gehört alles Aretha. Eine vollkommenere Gesangsperformance hat’s vielleicht nie gegeben. – David Numberger
Der Moment: Ein langer Moment, zugegeben. Aber die gut zwanzig Minuten von „Dr. Feelgood“ und „Spirit In The Dark“, Letzteres im Duett mit Ray Charles, sind ein einziges grandioses Wechselspiel aus Spannungsaufbau und Ekstase.
6. Talking Heads – STOP MAKING SENSE

Zugegeben: Ohne den Konzertfilm von Jonathan Demme wäre STOP MAKING SENSE nur der halbe Spaß. Allein der monströse Anzug, den David Byrne für „Girlfriend Is Better“ trägt, war damals das Kinogeld wert. Vor allem aber mutierten die Talking Heads augenblicklich vom geschätzten Geheimtipp zum Mainstream-Hit, weil STOP MAKING SENSE nicht nur ein verkapptes Best-of-Album ist,sonderndieHits hier auch sehr viel fetter und knalliger zu hören waren als auf den Studioalben. Zu verdanken ist das nicht zuletzt der üppigen, für den Film auf insgesamt neun Musiker*innen aufgepimpten Besetzung. – Thomas Winkler
Der Moment: Nachdem Byrne zum Einstieg „PsychoKiller“soloaufderGitarreundmitBeat vom Kassettendeck spielt, kommt mit jedem neuen Song ein weiteres Bandmitglied auf die Bühne, dazu noch die zusätzlichen Musiker*innen, bis schließlich in „Burning Down The House“ erstmals die unvergleichliche Funkyness der Talking Heads in ihrer ganzen Glorie erstrahlen kann.
5. The Cure – CONCERT: THE CURE LIVE
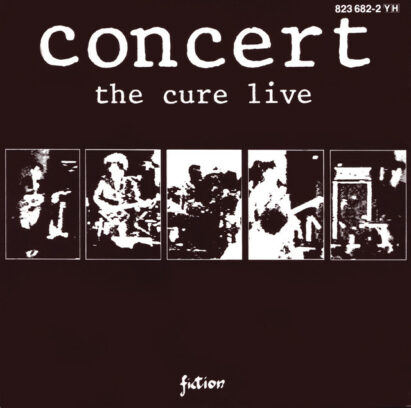
Das Dokument der dritten Wendung von The Cure: Was mit spartanischem Postpunk begann und in die lichtfreie PORNOGRAPHY-Phase führte, wird ab jetzt Pop. 1983 enttäuschen The Cure mit dem Calypso-Wave von „The Love Cats“ die Düsterfans, dieser Konzertmitschnitt entsteht kurz nach Veröffentlichung von THE TOP, das bis heute am wenigsten geliebte Cure-Werk der 80s. CONCERT ist aber kein Promo-Tool für diese Platte, sondern der Beleg dafür, dass The Cure willens sind, das vorherige Werk in den Pop zu transferieren. Selbst „The Hanging Garden“ und „One Hundred Years“ von PORNOGRAPHY erhalten ein wenig Licht, alte Favoriten wie „Killing An Arab“ oder „10:15 Saturday Night“ erstrahlen in neuen Farben, der Disco-Rhythmus von „The Walk“ zeigt die neue Richtung auf. Jedoch spielen The Cure hier wie aus einem Guss: zehn Songs, ein roter Faden, auf „The Love Cats“ wird verzichtet. Heute spielen The Cure stundenlange Konzerte. In Grunde reichen diese 42 Minuten. – André Boße
Der Moment: „Charlotte Sometimes“ ist schon auf FAITH ein Highlight, jedoch mit muffigem Sound, hier spielt die Band das Stück in einer klaren und majestätischen Version, die zusammenbringt, was The Cure groß macht: Schwermut und Melodie, Tod und Träume.
4. James Brown – LIVE AT THE APOLLO
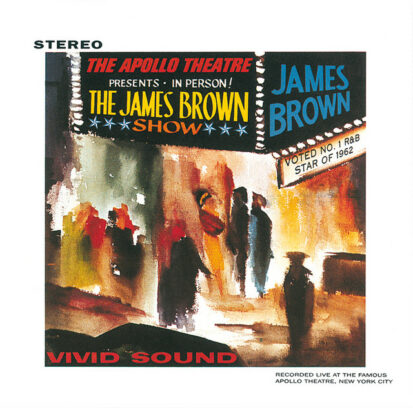
Der Jazz mochte die Grenze zwischen schwarzem und weißem Publikum bereits durchlässiger gemacht haben, doch im Pop-Sektor war Anfang der 60s noch fast alles beim Alten: Als am 24. Oktober 1962 im Apollo Theater in Harlem die Bandmaschine mitlief, standen R’n’B und Soul abseits der afroamerikanischen Community nicht allzu hoch im Kurs – was sich aber bald änderte. Und James Brown, von Organist und MC Lucas Gonda als „the hardest working man in show business“ angekündigt, hatte daran entscheidenden Anteil: Mit fulminanter Stimme, leidenschaftlicher Energie und einer beängstigend präzisen Live-Band hob er Tanzmusik auf ein neues Niveau. Das Album hielt sich 66 Wochen lang in den US-Charts. Dem Apollo-Programm kann man eigentlich nur einen Vorwurf machen: Nach knapp 32 Minuten Spielzeit ist die Messe gelesen. Dem Produzenten-Fachblatt „Mix“ gestand Wayne Kramer von den MC5 (siehe Platz 8): „Unser ganzes Ding basierte auf James Brown. Wir hörten LIVE AT THE APOLLO auf LSD, immer und immer wieder.“ – Uwe Schleifenbaum
Der Moment: wenn vor „Lost Someone“ ein Tusch den nächsten jagt und Reverend Brown den ekstatischen Gospelprediger gibt.
3. Portishead – ROSELAND NYC LIVE
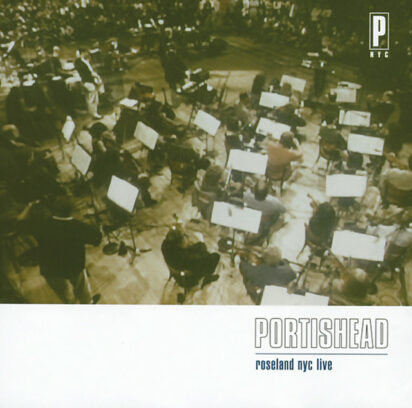
Portishead haben schon immer nach innen gerichtete Musik geschrieben. Dass ihr TripHop, der sich gerade Mitte bis Ende der 90er vor allem auf dem kurzen Dienstweg vom Kopfhörer ins Trommelfell schleppte, vor Publikum (!) in einem Ballsaal (!!) mit Orchester (!!!) aufgeführt werden sollte, konnte sich bis zu den Aufnahmen in New York, San Francisco und Norwegen niemand vorstellen. Das ist Musik, die man nicht teilt, die in einem wohnt. Die Intimität sollte sich aber perfekt auf die Bühne übertragen. Beth Gibbons Stimme, die zwischen den Zeitlupen-Beats, Twang-Gitarren und Geister-Synths ihr Leid klagt – meist zurückhaltend oder wie in „Sour Times“ mit ungewohnter Wucht und Lautstärke – dominiert im ruhigsten Sinne des Wortes diesen Abend und trifft jeden um sie herumsitzenden Menschen zielsicher dort, wo es schmerzt. Kein bisschen der Studio-Stimmung verliert sich. Im Gegenteil. Spätestens hier wurden Portishead als Live-Band geboren. – Christopher Hunold
Der Moment: Das Publikum bleibt meist andächtig ruhig. Es fühlt sich fast so an, als sei jede Person die einzige hier. Bis unter Jubel kurz vor dem Ende „Roads“ angestimmt wird und der sonst so verhasste Fernsehgarten-Moment – das Mitklatschen – alle miteinander verbindet.
2. Ramones – IT’S ALIVE

IT’S ALIVE ist für den Punk das, was NO SLEEP ’TIL HAMMERSMITH für die Geschichte von Hardrock und Metal bedeutet: the live record to end all live records. Schnell hatte sich das UK in die Jungs mit den löchrigen Jeans verguckt, waren nicht nur die Frühadopter des aufkommenden Punk-Phänomens, sondern auch Sex Pistols, The Clash et al 1976 zu den Shows der Ramones gepilgert, um ihnen auf die flinken Finger zu schauen und Nektar für die Evolution der eigenen Band zu saugen. Kein Zufall also, dass die Wahl von Joey, Tommy, Johnny und Dee Dee auf Großbritannien als Turf für ihr erstes Live-Album fällt. Vier Shows werden während der Tour aufgezeichnet, die Wahl fällt auf jene vom 31. Dezember 1977. Im Londoner Rainbow Theatre fliegen die Sitze, ein euphorisches Publikum verabschiedet das Jahr mit universellem „Hey-ho, let’s go“. Die Tracklist – 28 Songs auf vier LP-Seiten – verdampft das Beste der ersten drei Alben zu einem Hitblitz: „Rockaway Beach“ macht den Auftakt, „We’re A Happy Family“ den Rausschmeißer. Haken dereinst: Mit dem Release im April 1979 ist das Momentum passé. Aus heutiger Sicht eine Petitesse, ist die Energie dieses Mitschnitts doch ungebrochen. – Ingo Scheel














